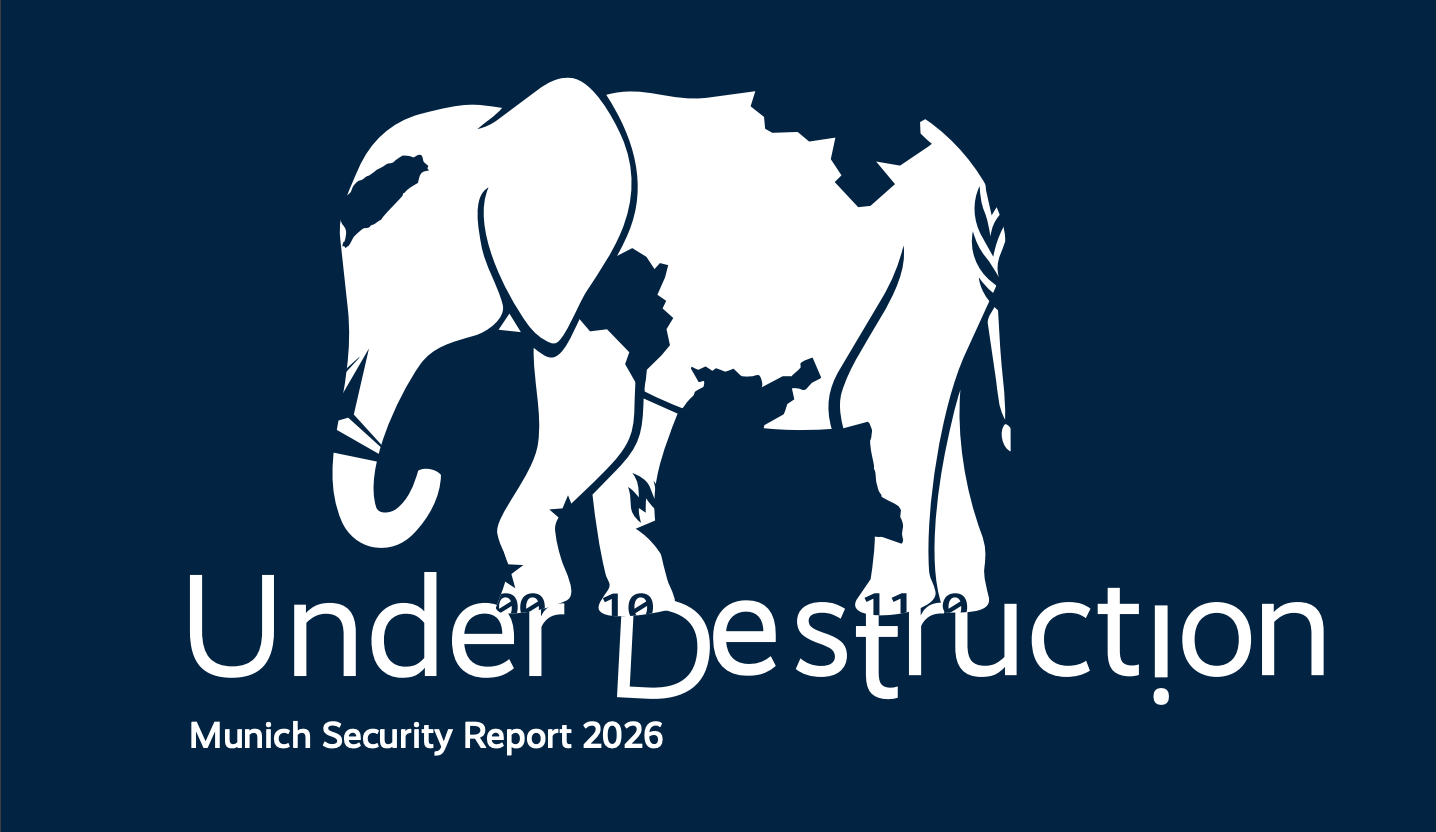diplo.news
Das Ende der Megafon-Diplomatie
Kolumne von Michael Backfisch

US-Präsident Donald Trump trifft sich gerne mit den Autokraten dieser Welt. Aber am kommenden Dienstag empfängt er einen, der vor nicht allzu langer Zeit in den westlichen Ländern für das große Gruseln sorgte. Wenn der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman, der de-facto-Herrscher des Wüstenstaates, in Washington landet, geht es um Buddy-Politik der besonderen Art. Trump fühlt sich zum Prunk und Reichtum der Golf-Monarchien hingezogen. Er schätzt zudem die strengen Top-Down-Hierarchien, die dort funktionieren. Dem Saudi wiederum imponiert die wirtschaftliche Kraft, das politische Gewicht und die militärische Potenz der Supermacht.
Es stehen aber auch knallharte Interessen auf dem Spiel. Trump erhofft sich im Zuge seiner „America-First“-Politik bis zu eine Billion Dollar saudische Investitionen im Land. Eine Art Super-Injektion für die US-Unternehmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Darüber hinaus träumt er nach wie vor vom Friedensnobelpreis. Sein Plan zur Stabilisierung des Gazastreifens sei nur ein Zwischenschritt für einen „großen Frieden in Nahost“, betont Trump immer wieder. Ihm schwebt eine Aussöhnung der gesamten arabischen Welt mit Israel vor. In seiner ersten Amtszeit gelangen ihm 2020 die „Abraham Accords“: Zunächst nahmen die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, danach Marokko und der Sudan Beziehungen zu Israel auf. Käme jetzt noch die Öl- und Gasgroßmacht Saudi-Arabien dazu, könnte sich Trump auf der internationalen Bühne als großer Vermittler und Versöhner präsentieren. Kronprinz Mohammed bin Salman – auch unter dem Kürzel MBS bekannt – soll ihm dabei helfen. Deshalb bereitet der Präsident dem Gast aus Riad einen glamourösen Empfang im Weißen Haus.
MBS wiederum geht es um zwei Dinge. Er will amerikanische Nukleartechnologie für den Bau und Betrieb von Kernreaktoren. Die produzierte Energie soll vor allem in den Binnenverbrauch fließen, um mehr Öl exportieren zu können, was zusätzliches Geld in die Staatskassen spült. Zweitens strebt der Kronprinz einen Verteidigungspakt mit den USA an, samt Lieferung modernster Waffen wie F-35-Kampfjets. Der große regionalpolitische Gegenspieler Iran ist zwar deutlich geschwächt, doch MBS denkt an langfristige Eindämmung.
Beim Ziel, die Islamische Republik in Schach zu halten, überschneiden sich die Interessen Amerikas und Saudi-Arabiens – und übrigens auch Israels. Die Nuklear- und Militärpläne des Kronprinzen dürften beim US-Präsidenten auf Resonanz stoßen. Im Gegenzug hat MBS bereits zugesagt, dass sein Land bis 2028 rund 600 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren werde. Das liegt zwar unter Traums Wunschzahl von einer Billion Dollar, ist aber dennoch ein beträchtlicher Betrag. Die Anerkennung Israels wird der Saudi indessen auf Eis legen, bis eine glaubhafte „Road-Map“ zur Bildung eines unabhängigen Palästinenserstaates vorgelegt wird. Solange Israels Premier Benjamin Netanjahu von rechtsextremen Koalitionspartnern abhängig ist, bleibt dies jedoch ein utopisches Projekt.
Die Interessen-Konvergenz zwischen Trump und Mohammed bin Salman ist erstaunlich. Die Frage der Menschenrechte bleibt völlig außen vor. Die öffentlichen Hinrichtungen oder das Auspeitschen von Oppositionellen, die im Königreich gang und gäbe sind, spielen für den Chef des Weißen Hauses keine Rolle. Kein Wort auch zur brutalen Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Kashoggi im Jahr 2018, die der Kronprinz laut CIA in Auftrag gegeben hatte. Unter US-Präsident Joe Biden galt Saudi-Arabien noch als Paria-Staat. Biden begriff Amerika als Führungsmacht demokratischer Länder in der Auseinandersetzung mit den Autokratien dieser Welt.
Tempi passati. Im Trump-Zeitalter der Disruption gilt das Prinzip: interessengeleitete Diplomatie First, Menschenrechte Second. Man muss nicht komplett in Zynismus oder Nihilismus verfallen. Aber der Moment ist gekommen, bohrende Fragen zu stellen: Ist die EU, ist die deutsche Politik mit ihrem Mantra, „westliche Werte“ zu verteidigen, noch in der richtigen Spur? Klingt nicht der Anspruch, weltweit der letzte Hort von Demokratie und Rechtsstaat zu sein, mittlerweile nur noch hohl? Hat sich die Vorstellung, auf dem Hochsitz der moralischen Überlegenheit zu sitzen, nicht von selbst erledigt?
Europa und Deutschland haben zu lange ausgeklammert, was die eigenen Interessen sind. 2019, zu Beginn ihrer Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin, hatte Ursula von der Leyen eine „geopolitische Kommission“ versprochen. Die Gemeinschaft solle sich im „Großmächtewettbewerb“ behaupten, Europa müsse „die Sprache der Macht“ lernen, forderte sie. Eine Wolkenkuckucksheim-Rhetorik, die bis heute nicht mit konkreten Inhalten unterfüttert wurde. Die Interessen der EU bleiben eine Leerstelle.
Das gilt auch für Johann Wadephul. Der Außenminister reist rund um den Globus, schweigt sich aber über deutsche Interessen aus. Mal beschwört er die islamistische Hamas, die Waffen niederzulegen. Mal präsentiert er sich als Bannerträger der Menschenrechte. So sei es syrischen Flüchtlingen in Deutschland nicht zuzumuten, in ihre Heimat zurückzukehren, da dort „wirklich kaum Menschen richtig würdig leben“ könnten, sagte Wadephul kürzlich in einem Vorort von Damaskus. Dass sich nach Angaben des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) seit Dezember 2024 mehr als eine Million Syrer aus dem Libanon, Jordanien und der Türkei auf den Weg nach Hause gemacht haben, erwähnt er nicht. Von Wadephul kommen vor allem moralinsaure Appelle, Ermahnungen und Bedenken. Er hört sich an wie ein Echo seiner Vorgängerin Annalena Baerbock. Doch Megafon-Diplomatie passt nicht mehr in diese Zeit.