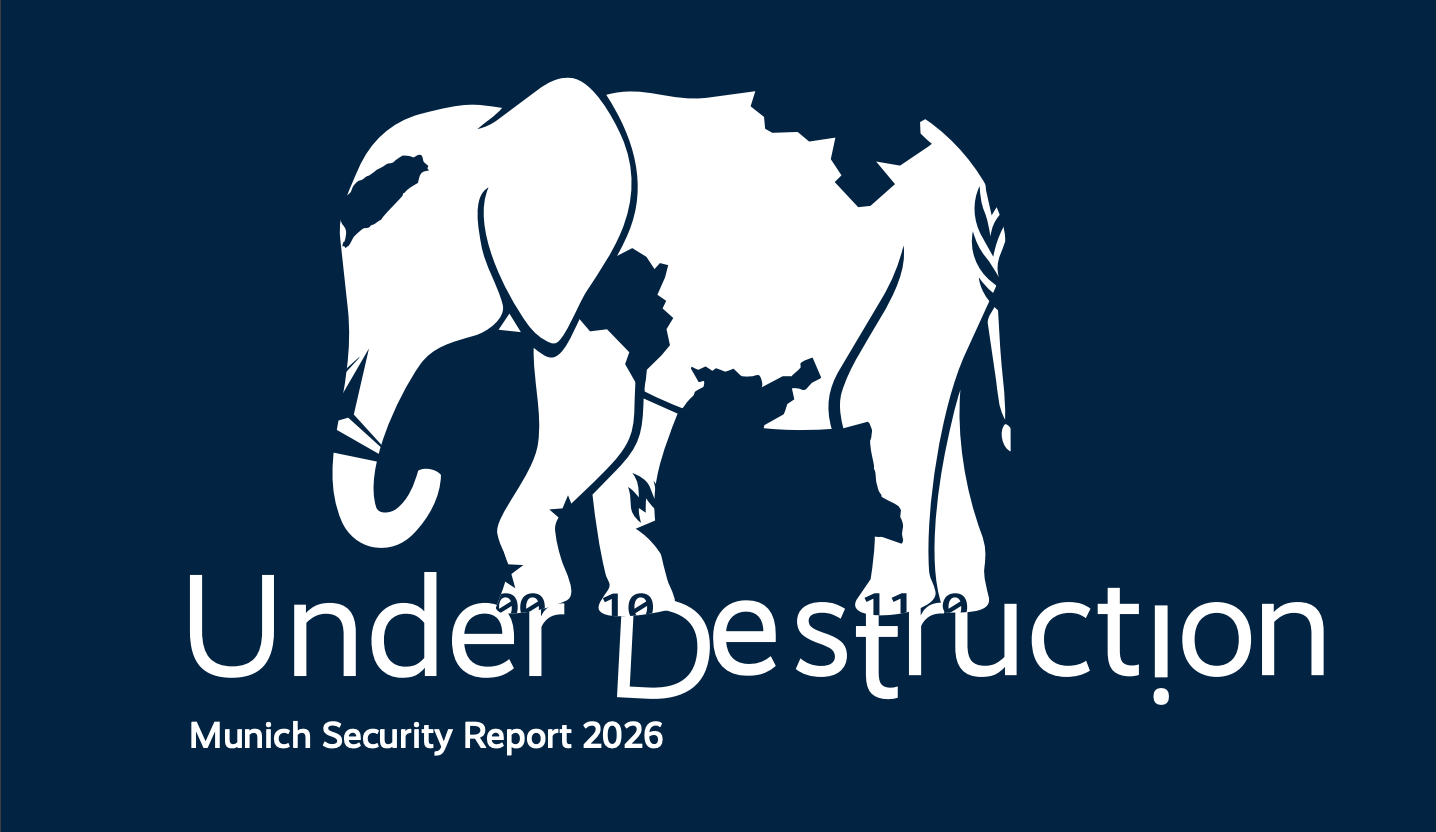diplo.news
"Der Zeitpunkt für eine umfassende Neuordnung des Nahen und Mittleren Ostens wäre günstig."
Interview von Gudrun Dometeit

Welche innenpolitischen Folgen hat der Zwölf-Tage-Krieg zwischen Israel und dem Iran auf das iranische Regime? Laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wie auch nach den Worten von US-Präsident Donald Trump war neben der Zerstörung der Nuklearanlagen ein Regimewechsel einer der Gründe für den Angriff.
Die innenpolitischen Folgen werden, fürchte ich, relativ gering bleiben. Der Oberste Führer Chamenei ist weiterhin im Amt, und selbst wenn er getötet werden sollte, dann ist das Regime nach dem bisherigen Eindruck nach wie vor stabil. Es gibt keine Anzeichen für einen Aufruhr von innen. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, dass die Iraner trotz aller Kritik am Regime die Angriffe Israels und der USA ablehnen, weil sie Chaos fürchten und diese Art von Gewalt ablehnen. Ein Regimewechsel oder nur eine Destabilisierung scheint nicht stattgefunden zu haben.
Was war Ihrer Meinung nach tatsächlich das Ziel der Angriffe?
In erster Linie war es sicher ein Schlag gegen die Nuklearstätten. Der Name der israelischen Aktion „Rising lion“ (Sich erhebender Löwe) spricht aber dafür, dass Netanjahu auf einen möglichen Regimechange abzielte, weil der Begriff auf ein Symbol des altpersischen Reiches anspielt. Zudem wurden ja nicht nur Atominstallationen angegriffen sondern auch das Staatsfernsehen, Energieanlagen und andere eher zivile Einrichtungen. Ob das auch die Idee von Trump war, ist schwer zu sagen. Aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Ich schließe nicht aus, dass zumindest Israel versuchen wird, Ajatollah Khamenei zu töten oder andere Destabilisierungsmaßnahmen zu unternehmen, in der Hoffnung, dass es zu einem Fall des Regimes kommt.
Solche Versuche in anderen Ländern haben sich in der Vergangenheit allerdings selten als erfolgreich erwiesen. Wieso sollte das jetzt anders sein?
Ich halte Versuche, extern einen Wechsel von Regimen herbeizuführen, tatsächlich für hochgefährlich, und im Iran zudem für wenig aussichtsreich. Im Irak - und in Afghanistan - ist der Versuch krachend gescheitert. In Syrien ereignete sich der Wechsel im wesentlichen von innen heraus. Und nur so wäre das auch im Iran realistisch, sonst riskieren wir Chaos und eine große Destabilisierung der Region. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Alternative zum jetzigen Regime sogar noch repressiver würde, ist wesentlich größer als die, dass es zu einer demokratischen Regierung kommt.
Trotz des Bombardements signalisiert der Iran weiter Verhandlungsbereitschaft. Der Gegenschlag auf US-Truppen in Katar erfolgte mit Vorwarnung und richtete offenbar kaum Schaden an. Will der Iran tatsächlich noch verhandeln, oder muss man in nächster Zeit eher mit massiven Gegenreaktionen rechnen?
Die Bereitschaft zu Verhandlungen ist sicher deutlich reduziert. Aus iranischer Sicht sind die Verhandlungen mit den Europäern wie auch mit den Amerikanern kompromittiert. Wenn man während einer laufenden Verhandlungsrunde auf einmal Militärschläge durchführt, fragt sich die andere Seite natürlich, was solche Gespräche überhaupt bringen sollen. Die Iraner sehen zudem, was sonst in der Region passiert. Das Abkommen mit der Hamas über einen dreistufigen Waffenstillstand in Gaza hat Israel nach der ersten Stufe aufgekündigt, die Vereinbarungen mit dem Libanon über einen Rückzug aus dem Süden des Landes nicht umgesetzt. Trump hat den Abkommen zugestimmt, aber im Grunde sind beide gebrochen worden. Die Iraner fragen sich also, ob die Amerikaner denn dann Verhandlungsergebnisse mit dem Iran einhalten. Schließlich sind sie 2018 auch aus dem funktionierenden Abkommen über das iranische Atomprogramm (JCPOA) ausgestiegen. Nach Aussagen des damaligen Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) war der Iran das am besten überwachte Mitglied des Atomwaffensperrvertrags.
Der Iran hat die Zusammenarbeit mit der IAEO gerade nur suspendiert und nicht – wie Nordkorea 2003 – den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag erklärt. Lässt das darauf schließen, dass es noch Verhandlungsmöglichkeiten gibt? Wenn auch nicht mit den Europäern, weil diese ja ganz offensichtlich keinen Einfluss haben.
Dass die Genfer Gespräche Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit dem Iran (am 20. Juni, d. Red.) nicht zu einem belastbaren Ergebnis führen würden, war eigentlich klar. Die Drei haben aber den absolut wichtigen Versuch unternommen, überhaupt erst mal wieder in einen Verhandlungsprozess einzusteigen. Das ist halt nicht erfolgreich gewesen, aber man muss es probieren. Die Aussetzung des Abkommens mit der IAEO ist ein schlechtes Zeichen. Bei optimistischer Betrachtung könnte man den letzten Schritt zum Austritt noch als letzten Versuch interpretieren, Verhandlungen nicht völlig auszuschließen. Ob diese Interpretation richtig ist, wird die Zukunft zeigen. An einer weiteren kriegerischen Auseinandersetzung mit den Amerikanern ist der Iran nicht interessiert. Das war schon seit dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 so. Teheran hat zwar die Hamas finanziell unterstützt und stark gemacht, ebenso wie die Hizbollah, aber deren Angriffe auf Israel hat das Regime nicht gebilligt, die wollte es für einen späteren Zeitpunkt aufheben. Das zeigt wie gefährlich es ist, Proxies, also Stellvertreter, aufzubauen, wenn die ein anderes Spiel spielen. Für den Iran hat es desaströs geendet. Dass die Israelis dieses unklare und riskante iranische Spiel nicht mitmachen wollten, ist nachzuvollziehen. Gespräche hängen davon ab, ob man deren Glaubhaftigkeit wiederherstellen kann.
Europa ist so gut wie einflusslos im Nahen Osten. Deutschland unterstützt Israel fast bedingungslos – trotzdem hat es auch dort offenbar nicht mehr Einfluss. Woran liegt das?
Europa hatte lange eine moralische Glaubwürdigkeit in der Region. Sie ist bei den arabischen Staaten sehr geschwunden. Unsere Argumente werden nicht geteilt - das ist ein Fakt, den wir zur Kenntnis nehmen müssen. Auf israelischer Seite zählen nur die Amerikaner, weil sie bereit sind, härtere Maßnahmen durchzusetzen. Auch Trump ist ja durchaus kritisch in manchen Fragen gegenüber Israel gewesen in den vergangenen Monaten. Die Europäer werden von Israel als Partner nicht ernst genommen, weil sie letztendlich mit ihren Argumenten nicht überzeugend wirken und offenbar keine Zwangsmaßnahmen durchsetzen wollen. Damit scheiden sie im Grunde genommen als ernstzunehmender Verhandlungspartner aus.
Die Europäer müssen demnächst entscheiden, ob sie Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft treten lassen, weil die im JCPOA festgelegte Frist ausläuft. Ist das noch ein Hebel, um etwas zu bewirken? Wie lautet Ihre Empfehlung als ehemaliger Botschafter und Experte in der Region?
Wir müssten zuallererst unsere Interessen definieren. Sind sie ausschließlich bestimmt durch die Unterstützung der israelischen Regierung, oder gibt es da auch noch andere Aspekte? Die Lehre aus unserem Einsatz in Afghanistan war doch, dass man sich die gesamten Umstände der Region vorher genau ansehen muss. Das sollten wir auch in der jetzigen Situation befolgen. Ich würde sehr nüchtern analysieren und fragen, wie wir welche Ziele erreichen können. Diese Interessendefinition vermisse ich im Augenblick auf deutscher Seite. Es wäre ein wichtiger Schritt, darüber innerhalb der Bundesregierung und durchaus auch öffentlich und gerne auch kontrovers zu debattieren.
Der neue Außenminister Johann Wadephul ist kritisiert worden, weil er die US-Bombardements auf den Iran als bedauerlich bezeichnet hat. Eine neue Nahoststrategie kann aber doch nicht blind den Amerikanern folgen. Der Militärschlag war für die weiteren Entwicklungen in der Region hochgefährlich.
Ich würde mich eher an unseren Interessen orientieren. Ein Regimewechsel im Iran könnte Chaos hervorbringen und damit zu Flüchtlingsbewegungen in die Nachbarstaaten führen, auch in die Türkei. Deren Staatschef Recep Tayyip Erdoğan hat schon erklärt, dass er iranische Flüchtlinge Richtung Europa nicht aufhalten werde. Aus Syrien kamen dorthin einst fast vier Millionen Flüchtlinge, über eine Million nach Deutschland – bei 20 Millionen Einwohnern. Der Iran hat aber 90 Millionen Einwohner. Zum zweiten besteht unsere Glaubwürdigkeit - auch wegen der Folgen des Zweiten Weltkrieges und des furchtbaren Erbes des Holocausts – darin, eine regelbasierte Weltordnung anzustreben, in der nicht das Recht des Stärkeren gilt. Der Nahe Osten hält den Angriff auf den Iran für eindeutig völkerrechtswidrig, weil keine unmittelbare Bedrohung bevorstand, und deshalb lautet dessen Schlussfolgerung, dass eine regelbasierte Politik nicht mehr gilt, jedenfalls nicht für alle, sondern nur das Recht des Stärkeren. So haben wir ja auch immer in der Ukraine argumentiert und deshalb Russlands Krieg als völkerrechtswidrig eingestuft. Wir haben weder Interesse daran, eine regelbasierte Außenpolitik aufzugeben noch an großen Flüchtlingsströmen. Deshalb rate ich nicht dazu, nur auf eine Gefolgschaft der Amerikaner oder der israelischen Regierung zu setzen.
Für wie gravierend halten sie die Auswirkungen des Krieges auf die Region? Zum Beispiel auf Staaten wie Syrien oder den Libanon, die selber um ihre innere Stabilität ringen. Wie groß ist die Gefahr einer Eskalation?
Die Stabilität im Irak könnte wieder aufbrechen, weil es dort viele Schiiten gibt und dort gerade über einen eigenen sunnitischen Staat diskutiert wird. Die gesamte Ordnung der Region droht durcheinanderzugeraten. Auch Terrorismus könnte sich wieder ausbreiten, weil immer mehr Gruppierungen Europäern und Amerikanern die Schuld an dieser Lage geben. Im Libanon und in Syrien kann die Schwächung des Iran dagegen zu einer Stabilisierung führen. Das haben die vergangenen Wochen gezeigt. Sie muss aber weiter aktiv betrieben werden. Sie kommt nicht von alleine.
Bestärken die jüngsten Ereignisse um den Iran die Ambitionen für eine atomare Bewaffnung, weil sich einige Länder sagen: Offensichtlich schützt uns ja nur noch eine nukleare Bombe vor dem nächsten Angriff der Amerikaner?
Das ist leider eine Schlussfolgerung, die vermutlich gerade autoritäre Staaten daraus ziehen. Der Iran hat 2003 sein offizielles Atomwaffenprogramm aufgegeben, sich aber weiterhin für die friedliche Nutzung eingesetzt. Auch Muammar al-Gaddafi gab im selben Jahr das Nuklearwaffenprogramm in Libyen auf und wurde zehn Jahre später durch einen Nato-Einsatz mit Genehmigung der UN getötet. Völkerrechtlich unterschied sich die Situation, trotzdem dürften viele zweifeln, ob die Aufgabe der richtige Weg ist. Sie sehen nach Nordkorea, Pakistan oder Indien, die die Bombe einfach entwickelt und dann gesagt haben: So, nun haben wir sie. Ägypten hat jahrelang versucht, eine Initiative für eine atomwaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten umzusetzen, ist auch dem Kernwaffensperrvertrag beigetreten in der Erwartung, dass Israel folgen werde.
Netanjahu kämpft gegen den Iran, vor allem dessen Atomwaffen, seit Jahren geradezu besessen. Spielt dabei nicht nur die Sicherheit des Landes eine Rolle sondern auch der Wunsch nach einer Art atomarer Hegemonie in der Region? Anders kann man – außer mit einigen taktischen Argumenten - ja nicht erklären, warum Israel jetzt, obwohl es keine Anzeichen für eine akute Bedrohung gab, angegriffen hat.
Offiziell hat Israel ja nie erklärt, Atomwaffen zu haben… Es spricht tatsächlich einiges für dieses Motiv. Die Frage ist, ob wir Europäer Israel weltweit eine Ausnahmesituation zugestehen, weil es eben Israel ist und außerhalb des Rechtssystems steht. Oder ob sich Israel nicht auch dem internationalen Völkerrecht unterordnen muss. Das kann man so oder so beantworten, aber ich glaube, diesem Thema müssen wir uns stellen – auch im Rahmen unserer eigenen Interessendefinition.
Kann der US-Militärschlag gegen die Nuklearanlagen eigentlich auch Positives bewirken? Weil die Zerschlagung von Bestehendem neue Ideen für die ewigen Konflikte im Nahen Osten hervorbringen könnte?
Die Veränderung des iranischen Einflusses, den ja auch die arabischen Staaten sehr kritisch gesehen haben, könnte man für eine umfassende Neuordnung des Nahen und Mittleren Ostens nutzen, etwa nach dem Beispiel der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Angesichts der jetzigen Machtstrukturen wäre der Zeitpunkt günstig, setzt aber voraus, dass die Staaten auf allen Seiten dafür geeignete Führer haben. Das scheint mir augenblicklich unwahrscheinlich zu sein, sodass ich befürchte, dass diese Chance wieder einmal nicht genutzt wird, um einen umfassenden Frieden herbeizuführen, sondern dass man in einer militärischen Konfrontation verharrt.
Die UN wollten auf Anregung von Frankreich und Saudi-Arabien eine Konferenz zur Zwei-Staatenlösung für Israel und Palästina abhalten, haben diese aber wegen der Spannungen um den Iran verschoben. Die einen sagen, die Idee sei sowieso tot, die anderen wollen sie wiederbeleben. Wie sehen Sie das?
Abschließende Sicherheit und das Existenzrecht Israels kann nur über seine Legitimität in der Region erfolgen, durch die Anerkennung der arabischen Staaten. Ägypten und Jordanien haben das beide in den jeweiligen Friedensverträgen getan - unter der Voraussetzung, dass die Palästina-Frage geklärt wird. Die anderen Staaten haben in der arabischen Friedensinitiative schon 2003 das Existenzrecht Israels in Aussicht gestellt, wenn die Palästinenser-Frage im Sinne einer Zwei-Staatenlösung geregelt wird. Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und Sudan haben 2020 in den sogenannten Abraham-Verträgen Israel anerkannt - mit der Perspektive, dass die Palästina-Frage in irgendeiner Form gelöst wird. Das zeigt, dass auch das ultimative Ziel unserer Staatsräson – die Sicherheit und das Existenzrecht Israels - ohne eine einvernehmliche Lösung der Palästina-Frage nicht realistisch ist. Dies gilt es jetzt allerdings auch diplomatisch herbeizuführen, denn Israel kann ja nicht in den nächsten 500 Jahren seine Existenz nur mit Waffen verteidigen. Ausgerechnet das furchtbare Massaker der Hamas 2023 hat die arabischen Staaten zum ersten Mal dazu gebracht, sich aktiv für eine Lösung dieses Konfliktes einzusetzen.
Israel hat bislang in der Außenpolitik eher auf die Stärke seiner Armee als auf die des Wortes gebaut. Könnte es sein, dass es sich darin nun noch mehr bestärkt fühlt, weil der Angriff auf den Iran gelungen ist? Wie verhandlungsbereit ist Israel Ihrer Meinung nach?
Dass sich das Land auf seine Verteidigungsfähigkeit verlassen hat, halte ich für außerordentlich nachvollziehbar. Aber es hat auch auf diplomatische Mittel gesetzt, die Friedensabkommen mit Jordanien und Ägypten sind markante Beispiele. Nach dem Oslo-Abkommen in den neunziger Jahren hatte Israel seine friedlichste Zeit. Eigentlich gäbe es auch jetzt sehr gute Voraussetzungen, den friedlichen Ausgleich mit seinen Nachbarn Libanon und Syrien zu stärken. Aber statt die libanesische Regierung und Armee zu stärken, bombardiert Israel den Südlibanon weiter und gibt damit der Hisbollah einen Vorwand, die Waffen nicht abzugeben. In Syrien kontrolliert es weiterhin Gebiete, in die es nach dem Sturz des Assad-Regimes eindrang und die über das 1967 eroberte Territorium hinausgehen. Das ist demütigend für die Syrer. Es wäre nun eine Gelegenheit für Israel, natürlich nicht abzurüsten aber auf die Nachbarstaaten zuzugehen.
In Deutschland ist immer wieder von der Sicherheit Israels als deutscher Staatsräson die Rede. Aber was heißt das eigentlich? Müsste man sich nicht, statt nur der Politik israelischer Regierungen zu folgen, mehr damit auseinandersetzen, wie die Sicherheit Israels geschützt werden kann? Die Vorgehensweise gegen die Palästinenser in Gaza beispielsweise sät Hass und züchtet die nächste Terroristengeneration.
Der Begriff ist vor vielen Jahren mit Inhalt gefüllt worden. Sicherheit heißt, es darf keine Terrorangriffe geben. Das Existenzrecht bedeutet, dass Israel als europäischer Neuankömmling im Nahen Osten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen neuen Standort hat, den die arabischen Staaten durch Botschafteraustausch anerkennen, und dass seine Grenzen sicher sind, ob das die von vor dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 oder andere sind. Das ist die Grundformel, an die wir uns häufiger erinnern sollten.