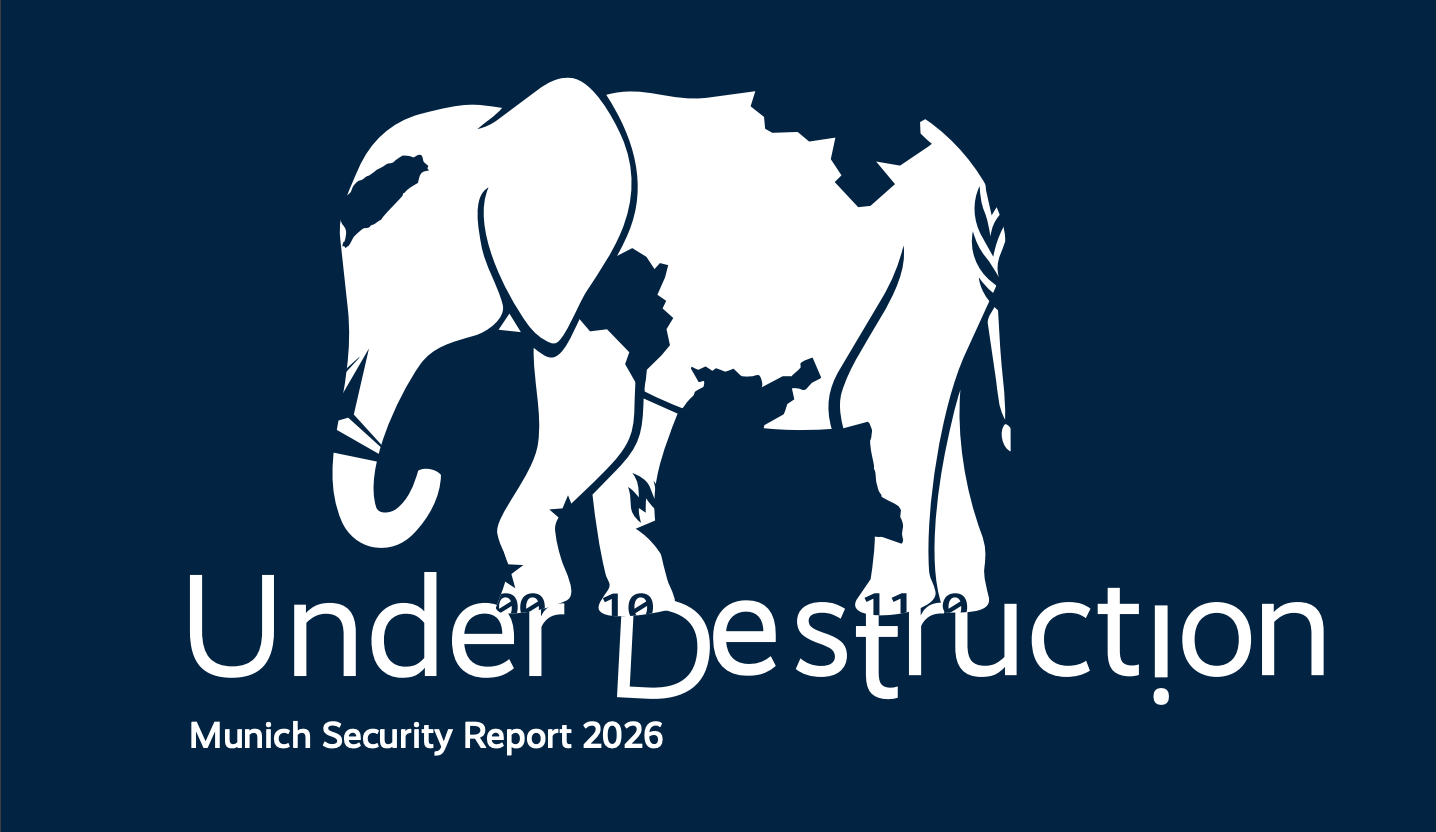diplo.news
Die DGAP verstärkt die sicherheitspolitische Analyse

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hat eine scharfe Kontrolle der Verteidigungsausgaben in Europa und Deutschland gefordert. Wenn soviel Geld im Spiel sei, bestehe die Gefahr, dass dass es "rausgeschmissen" werde, beispielsweise für Dinge, die vielleicht vor 20 Jahren wünschenswert gewesen aber heute überholt seien, sagte die Europapolitikerin bei der Eröffnung des neuen Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Sie hoffe auch, dass die Rüstungsunternehmen in dieser Situation nicht die Preise erhöhten. Investitionen in die militärische Forschung hätten allerdings auch immer einen Mehrheit für die zivile Sicherheit, sie könnten zum Beispiel neue Jobs schaffen. Die 27 EU-Staaten geben mittlerweile Rekordsummen für Verteidigung aus, bisher 341 Milliarden Euro, und in diesem Jahr soll die Summe auf 381 Milliarden steigen. Im März hatte die EU einen Aufrüstungsfonds von 150 Milliarden Euro beschlossen.
Das neue Zentrum der DGAP, einer der wichtigsten Thinktanks in Deutschland, will angesichts der sicherheitspolitischen Umbrüche eine Plattform für Analyse und Diskussion sein. Er wünsche sich, so Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in einer Videobotschaft, dass es nicht nur Expertise bündeln sondern auch Raum für kritische Debatten und neue Fragestellungen bieten werde. Pistorius musste seine ursprünglich vorgesehene persönliche Teilnahme zugunsten eines Treffens mit seiner neuen französischen Amtskollegin Catherine Vautrin in Paris absagen. Das Zentrum leitet der Politikwissenschaftler Patrick Keller, zuvor unter anderem für Politik und Kommunikation beim Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und als Redenschreiber unter den Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) tätig. Zu den Förderern des Zentrums gehören unter anderen die Deutsche Bank, SAAB und das Rüstungs-Start-up Helsing. Die DGAP will im kommenden Jahr auch ein Tech-Cluster aufbauen, um, wie Otto-Wolff-Direktor Thomas Kleine-Brockhoff betonte, die strategische Bedeutung disruptiver neuer Technologien besser verstehen zu können.
Ralph Tiesler, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wies darauf hin, dass nun zum ersten Mal in Deutschland innere und äußere Sicherheit zusammengedacht würden. Ohne zivile Verantwortung sei militärische Planung auch gar nicht denkbar. Allerdings habe es der Zivilschutz schwerer als die militärischen Kräfte, weil er in einem föderativen Staat wie Deutschland eine einheitliche Krisenkoordination von Bund, Ländern und Kommunen organisieren müsse. Dies sei zum Teil sehr kleinteilig, weil beispielsweise jeder Bürgermeister darüber nachdenken müsse, welche Einsatzkräfte, Schutzräume oder Alarmsysteme er zur Verfügung stellen könne.
Auf die Frage Kellers, was Deutschland von der Ukrain lernen könne, antworte der DGAP-Experte für russische Militärpolitik, Andras Racz: „Wir können von ihr lernen, dass die Bedrohung real ist.“ Russland reformiere sein Militär in einer Weise, dass dies auf mehr oder größere Ziele als die Ukraine hinweise. Der gebürtige Ungar wies vor allem auf die extrem schnellen Innovationszyklen des Ukraine-Russlandkrieges hin. Ingenieure würden auf beiden Seiten in die kämpfenden Truppen integriert. Fiberoptische Drohnen beispielsweise, die erst vor einem Jahr auf dem Schlachtfeld aufgetaucht seien, hätten mittlerweile eine Reichweite von 80 Kilometern. Außerdem seien Größe und Kosteneffizienz wichtig, dieser Krieg verschlinge eine Unmenge an Ausrüstung. Jeden Tag verliere die Ukraine mehrere tausend Drohnen, in diesem Jahr werde sie mehr als 3,7 Millionen produzieren. Allerdings sei auch nicht alles auf westliche Streitkräfte übertragbar, unter anderem wegen anderer Sicherheitsstandards. So sei de Bewaffnung von Drohnen extrem gefährlich, in der Ukraine würden pro Monat zwischen 80 und 100 Drohnenpiloten durch unabsichtliche Explosionen getötet oder schwer verletzt. gd