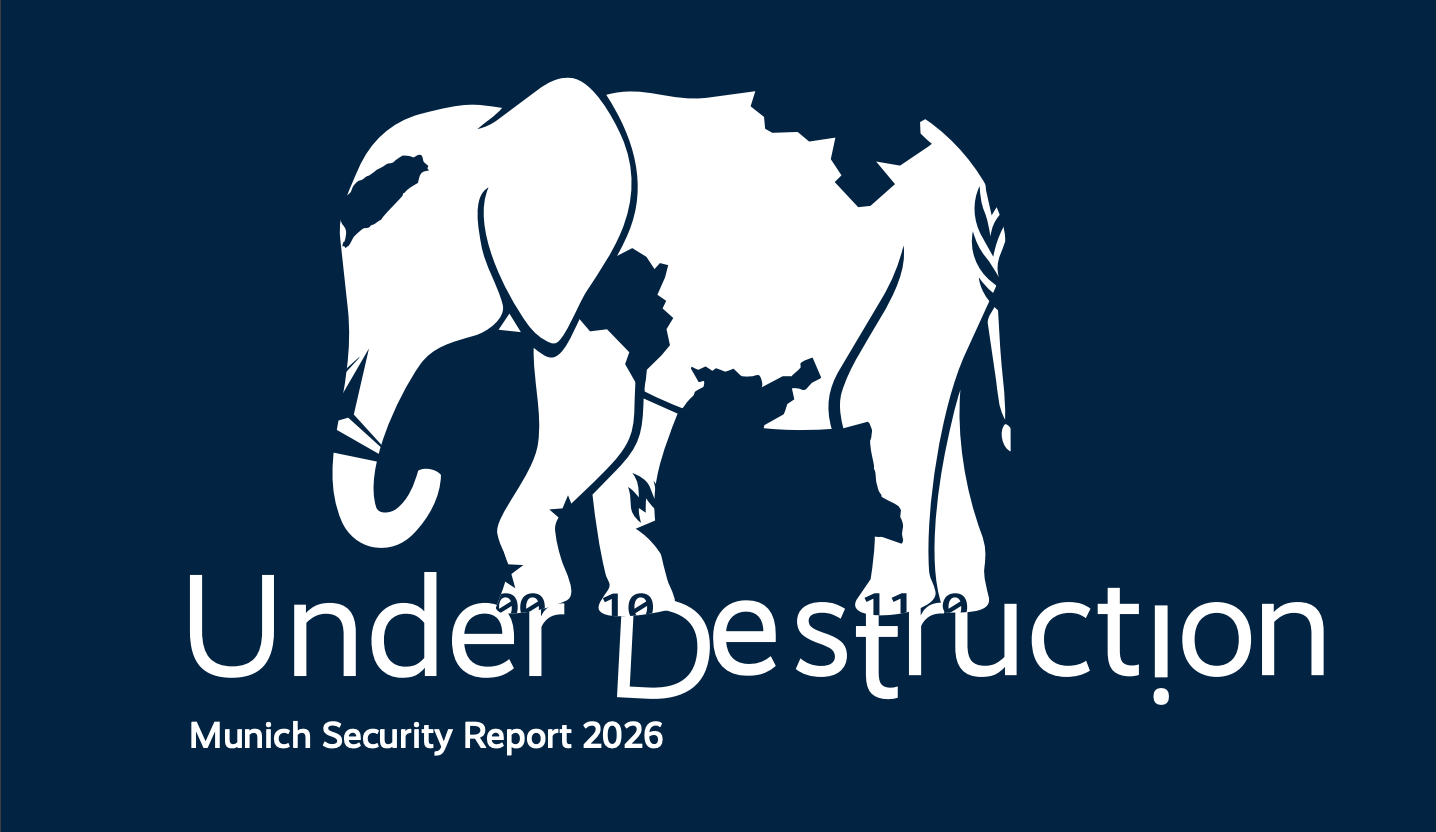diplo.news
Die Experteritis-Falle
Von Volker Stanzel

Diplomatie ohne Waffen sei wie ein Orchester ohne Instrumente, sagte Friedrich II. Die Zeit dieser Diplomatiephilosophie ist offenkundig zurückgekehrt. Heute versucht etwa Donald Trump, nach einem erfolglos gestellten Ultimatum, das iranische Atomprogramm mit Waffengewalt zu beenden. Und Israel, nach gescheiterten Gesprächen über die Freilassung der Geiseln, setzt auf eine Politik, die die Bevölkerung in Gaza aushungert.
Die Zeit, in der gemeinsame Konsenssuche die militärischen Instrumente gerade in den gefährlichsten Momenten und mit Hilfe Internationalen Rechts und der Internationalen Organisationen ersetzte, scheint vorbei. Der Iran selbst erkennt die Rückkehr zu einer Tradition im zwischenstaatlichen Verkehr: Der Stärkere gewinnt, und angesichts von Gewaltandrohungen ist man zu Verhandlungen bereit.
Auch Chinas Verhalten gegenüber Taiwan grenzt immer wieder an echten Krieg, ebenso gegenüber den Anrainern der Südchinesischen See. Verhandlungen, um in letzter Not Tod und Zerstörung vorzubeugen, kannte die Menschheit durch die Jahrhunderte gut genug – so gut, dass Friedrichs des II. Vergleich mit einem Musikorchester eher ironisch als zynisch erscheint.
So ist es kaum erstaunlich, wie sich die internationale Diplomatie auf ihre alten Eigenschaften zurückbesinnt. Vor nur wenigen Jahren versuchte Deutschland - Außenminister Heiko Maas -, eine „Allianz des Multilateralismus“ aus der Taufe zu heben. Es war eine durch und durch moderne Idee, aus dem Verständnis entstanden, dass das mit der UNO festgelegte Prinzip heißt, Problemlösung am effektivsten gemeinsam mit anderen betroffenen Staaten zu finden - jedenfalls ohne EInsatz von Gewalt. Auch die einstige Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland und anderswo kann man als Ausdruck eines neuen nationalen Empfindens verstehen, dass sich Interessen auf der internationalen Bühne leichter, nämlich durch Verzicht auf Waffengewalt und stattdessen mithilfe von Problemanalyse und -lösung befriedigend verfolgen lassen.
Dem passten sich in Deutschland auch die Reformen des Auswärtigen Dienstes an, zuletzt durch die Steinmeiersche des Jahres 2014, die versuchte, Probleme durch Expertenwissen und Aushandlung anzugehen. So setzte sie strukturelle Veränderungen aufs Gleis, die Problemfragen tendenziell immer mehr in die Hände von Fachexperten für dies oder jenes legten - im AA entstand sukzessive ein neuer organisatorischer Silo nach dem andern. Mit dem Einzug von Außenministerin Annalena Baerbock setzte sich der Ansatz fort, Politik traditionsfremd besser zu machen - auch hier durch die richtigen Strukturen und kluge Experten: „Feministische Außenpolitik“ würde feministische Anliegen schon durch die Besetzung von Posten rundherum mit Frauen durchsetzbar sein, Klima-Außenpolitik ganz ähnlich, geleitet durch eine administrationsferne Expertin.
Insofern ist die von Donald Trump rasch und aggressiv betriebene Schwächung des Auswärtigen Dienstes der Vereinigten Staaten die Vorbereitung auf eine Politik, die den Rückgriff auf die Gewalt der Waffen erleichtert - der Angriff auf den Iran war ein Beispiel dafür, wie simpel Diplomatie wieder geworden ist. Das diplomatische Parkett ähnelt nun frappierend dem, auf dem Friedrich II. sich bewegte - beunruhigend auch deshalb, weil die Summen, die jetzt verplant werden, um Deutschland kriegstüchtig - so der Verteidigungsminister - und zur stärksten Militärmacht auf dem Kontinent - so der Kanzler - zu machen, belegen, wie entschlossen wir nun auch auf die martialische Tradition zurückgreifen.
Dazu gehört, was der neue Außenminister bei der Übernahme seines Amtes ankündigte: Bald sollen wieder mindestens ebenso viele Diplomaten an Auslandsvertretungen tätig sein wie in der Berliner Zentrale – anders, als dies in Fortsetzung der Steinmeierschen Veränderungen in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Das, in die Sprache der bürokratischen Umsetzung übersetzt, heißt: Sachkenntnis, nicht theoretisch oder mithilfe von Thinktanks erworben, sondern vor Ort, im intensiven Austausch mit offiziellen oder nicht-offiziellen Vertretern des Gastlandes, mit anderen Vertretungen im Land, im Austausch von Person zu Person, mit den täglichen Telefonaten unter Kollegen und Kolleginnen auf der Arbeitsebene und ebenso unter Ministern und Ministerinnen.
Wenn wir uns also international vom schönen Schein des Multilateralismus verabschieden und uns ins Abenteuer einer „multipolaren“ Welt stürzen, muss uns klar sein, dass die Welt wiederkehrt, in der Macht Recht machte: Jedes Land ein Pol für sich; jeder kämpft für sich. Zugleich zeigt sich, dass die Welt Friedrichs II. auch Effektivitätsgewinne für die Diplomatie, damit für die Außenpolitik, damit für den Staat bedeuteten - solange die Instrumente nicht gespielt wurden. In unserer Zeit heißt das, die Erarbeitung abstrakter Strategien und vieler Papiere wird ersetzt durch das osmotische Entstehen von strategischem Einverständnis: Viele Treffen vieler Beteiligter, „Morgenrunden“oder „Direktorenrunden“ sind ergiebiger und damit wichtiger als das schematische Abarbeiten von Vorgaben.
Der Außenminister muss im Mittelpunkt eines echten Netzwerks stehen, dessen Meinung sich bildet auf der Grundlage von Erfahrung und dem Bewusstsein des „panta rhei,“ d.h.: die Welt ist ständig in Bewegung. Sich darin behaupten zu wollen, bedarf der Bildung von Fähigkeiten, wohl der Wehrhaftigkeit, aber in erster Linie des Denkens, Verstehens, Wissens. Austausch und Interaktion müssen an vorderster Front stehen, statt der abgeschotteten Silos in sich selbst versunkener Abteilungen. Das Handeln wiederum entsteht aus solchem Austausch, der zum Konsens über Zielsetzungen, Strategien, erforderliche Äußerungen führt. Dazu bedarf es in der Tat eines Ministeriums, dass weniger nach innen lebt als der Zusammenführung dessen dient, was im internationalen Verkehr tagtäglich der Fall ist.
So geht die gegenwärtige Order, „strategische Konzepte“ zu entwickeln, direkt ins Leere – beim besten Willen aller Mitarbeiter –, weil Politik nicht nach Rezepten vom Doktor oder Spielregeln aus dem Mensch ärgere dich nicht-Kasten entsteht. Oder, wie vielleicht jene Allianz für den Multilateralismus aus strategischen Meditationsübungen, die schließlich ins Vergessen führen. Darum ist es sicher taktisch klug, Zielsetzungen nur allgemein vorzugeben - „Freiheit, Wirtschaft, Sicherheit“ heißt das derzeit heilsam unkonkret in Berlin -, denn die Vagheit ist es gerade, die denkanregend wirkt.
Die beste Außenpolitik entsteht wie jede Politik. Das heißt: aus ungeplanten Entwicklungen heraus, aus Bedrängnis, aber auch aus Euphorie angesichts sich auftuender Möglichkeiten. So unschön es scheint, Friedrichs des II. Richtungsweisung ist wesentliches Element solcher gestalterischen Politik. Solche Gestaltung wartet nicht darauf, dass sich Partner und Gegner aufstellen wie auf dem Schachbrett, oder dass sie gar „strategisch“ plant - sie agiert. Und sie reagiert, möglichst schnell, durchschaut Konstellationen von Macht und Ohnmacht dank ihrer Erfahrung, reagiert wie immer möglich, korrigiert sich, und im Notfall spielt in der Tat jenes Orchester.
Konkrete Beispiele zeigen, wie ein geistesgegenwärtiger Willy Brandt 1969, ein Helmut Kohl 1989 zu Erfolgen gelangten. Erfolge haben allerdings den Nachteil, dazu zu verführen, immer mehr vom gleichen Triumph zu begehren – jedoch, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis ... ! Wie die USA 2003 nach dem ersten Sieg gegen Saddam, Russland 2022, nachdem es zum ersten und zweiten Mal den Westen 2008 und 2014 ausmanövriert hatte. Daher gehören Umsicht, Vorsicht, Achtsamkeit und, ja, konstante Wachsamkeit zu den Voraussetzungen von moderner Diplomatie wie von traditioneller. Erfolge lassen sich denken, am Go–Brett lassen sie sich wunderbar üben, die Realität aber lässt sich nur aus der Praxis her erfahren, und schaffen.
Abschließend ist zumindest zu fragen, ob die Rückkehr zu einer Diplomatie, die auf unmittelbarem Austausch, Erfahrung und situativer Anpassung beruht, wohl im Widerspruch zu modernen Technologien steht. Zu prüfen wäre, ob Künstliche Intelligenz nicht gerade dort unterstützen kann, wo es um die schnelle Analyse komplexer Situationen, das Erkennen von Mustern in Verhandlungsprozessen oder die Vernetzung von Informationen aus verschiedenen Quellen geht. So könnte KI dazu beitragen, das Orchester der Diplomatie besser zu stimmen und die Effektivität von Verhandlungen zu erhöhen – ohne jedoch die menschliche Urteilskraft und das Fingerspitzengefühl zu ersetzen, die - wie früher - unverzichtbar bleiben. Die Herausforderung wird sein, diese neuen Instrumente - statt der traditionellen, aus denen geschossen wird - klug und verantwortungsvoll einzusetzen, um die Kunst der Diplomatie im 21. Jahrhundert zu stärken - unter Rückgriff auf das Wissen vergangener Jahrhunderte.