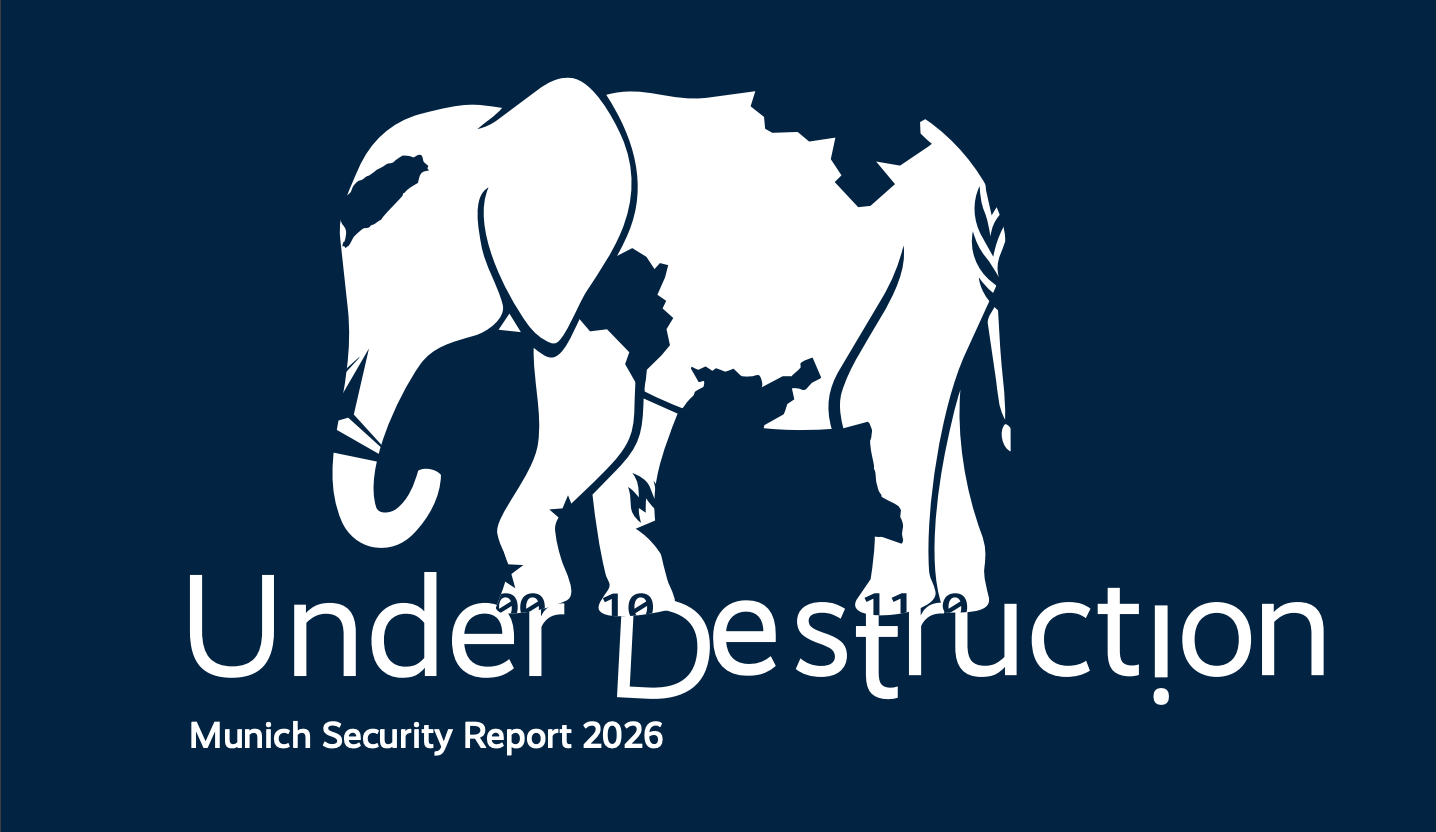diplo.news
Erinnerung und Zukunft
Von Gudrun Dometeit

Mehr werden es nicht. Irina Scherbakowa, Historikerin und Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsbewegung Memorial, wirkt enttäuscht. Gerade mal fünf Journalisten sind gekommen, um sie bei einer Rundfahrt durch Berlin zu Erinnerungsorten des Zweiten Weltkrieges zu begleiten. Die Tour soll eine Alternative sein – zu all den offiziellen Gedenkfeiern und -reden in der deutschen Hauptstadt am 8. Mai und den pompösen Militärparaden am 9. Mai, an dem Russland den 80. Jahrestag des Kriegsendes zelebriert. Sie will von menschlichen Schicksalen, persönlichen Erinnerungen erzählen, bewusst nicht an überdimensionalen Heldendenkmälern wie im Berliner Stadtteil Treptow Halt machen, wo ein Sowjetsoldat mit Kind und zerbrochenem Hakenkreuz vom Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland zeugt. „Er wird als russischer Recke dargestellt“, empört sich Scherbakowa. „Ein absoluter Mythos, in Wirklichkeit waren die sowjetischen Soldaten, die Berlin Anfang Mai 1945 einnahmen, unterernährt und sahen völlig anders aus.“
Mythen – das Wort wird die 76-Jährige, die seit zwei Jahren im Berliner Exil lebt, während des Rundgangs ziemlich häufig benutzen. Die Aufarbeitung der sowjetischen und russischen Vergangenheit, die Aufdeckung Stalinscher Verbrechen, geschichtliche Bildung für junge Russen – war der Sinn und Zweck der 1989 während der Perestrojka gegründeten Organisation Memorial. Eine echte Graswurzelbewegung, eine der ersten und selten genug in Russland. 2022 erhielt sie den Friedensnobelpreis, im eigenen Land ist sie mittlerweile aufgelöst.
Es ist ein heller strahlender Morgen in Berlins Mitte, die Frühlingssonne taucht die US-Botschaft, die Rückseite des berühmten Adlon-Hotels und das Holocaust-Denkmal in helles Licht. Besuchergrüppchen lauschen ihren Tour-Guides, ein Paar versucht auf der spiegelnden Fläche einer Info-Tafel zu entziffern, was zum ehemaligen Führerbunker, wenige Meter vom Denkmal für die ermordeten Juden entfernt, geschrieben steht. Nichts erinnert mehr an den noch zu DDR-Zeiten gesprengten Bunker, in dem Hitler sich in den letzten Kriegstagen das Leben nahm. Stattdessen präsentiert sich dort ein Parkplatz als Ausdruck absoluter geschichtsloser Neutralität.
„Die ganze Berliner Operation“, wie Scherbakowa die zweiwöchige Schlacht um Berlin nennt, sei ein Mythos, der Angriff habe zu einem sinnlosen Verlust von Menschen geführt, jedoch gefeiert als heldenhafte „Befreiung“ in sowjetischen Filmen, die auch in der DDR sehr populär gewesen seien. Unter Historikern kursiere eine Anekdote, nach der entweder der britische Premier Winston Churchill oder US-Präsident Franklin D. Roosevelt Stalin in den letzten Kriegswochen gesagt habe, man werde sich ja in Berlin sehen. Darauf habe Stalin geantwortet: Na,dann herzlich willkommen! Mit anderen Worten, der sowjetische Diktator hatte gar nicht vor, eine angebliche Absprache mit den Alliierten einzuhalten, die Stadt mit ihren 2,8 Millionen Einwohnern nicht direkt anzugreifen und einzunehmen. Aber warum nicht? „Er traute den Alliierten nicht“ , sagt Scherbakowa.

Auch die Eifersüchteleien und das Konkurrenzdenken unter den sowjetischen Marschällen hätten dabei eine Rolle gespielt, der Ehrgeiz von General Georgij Schukow, der um jeden Preis die Seelower Höhen östlich von Berlin erobern wollte. Dass dabei alleine über 38 000 Soldaten gefallen seien, viele sogar durch eigenen Artilleriebeschuss, habe nie in sowjetischen Geschichtsbüchern gestanden, so Scherbakowa. Stalin verbot seinen Generälen später, ihre Erinnerungen, vor allem zu den Kämpfen um Berlin, zu schreiben. In einem nach dem Krieg abgehörten Telefongespräch thematisierten Offiziere die vielen sinnlosen Befehle – und Stalin reagierte mit Repressionen gegen die Kritiker. Aber auch offiziell war der 9. Mai – der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht - ab 1947 und in den Folgejahren kein Feiertag.
Hitlers Gebiss in der Zigarettenschachtel
Scherbakowa hat anscheinend fast vergessen, dass sie vor dem Führerbunker steht, als sie sich einer der meistdiskutierten Fragen, nämlich der nach dem Ende von Hitler, zuwendet. „ Ich kannte Jelena Rschewskaja“, sagt sie, „die Frau, die mit ihrem Trupp damals die Leichen entdeckt hat, von Kindheit an. Sie war mit meinem Vater befreundet.“ Adolf Hitler und Eva Braun erschossen sich und ließen sich vor dem Bunker verbrennen. Aber Rschewskaja und ihre Kameraden waren sich nicht sicher, ob es sich wirklich bei den Überresten um das Paar handelte. „Man übergab ihr das Gebiss von Hitler in einer Zigarettenschachtel, während alle nach Hitlers Zahnarzt suchten. Sie hatte furchtbare Angst es zu verlieren, weil es ja der einzige Beweis war“ ,so Scherbakowa, die die Geschichte der Rscheskaja, einer jüdischen Dolmetscherin, dramatisch, seltsam, tragisch findet. Schließlich fand man die Assistentin des Zahnarzts.
Zweimal meldete sich die junge Russin damals bei den sowjetischen Truppen, um zu sagen, wovon sie überzeugt war: Dass es sich wirklich um Hitler handelte und er sich umgebracht habe. Null Reaktion. Auch Stalin leugnete bis Ende 1945 alle Beweise. „Er wollte wohl die wahren Nachweise nur für sich haben, und gleichzeitig behaupten können, der wahre Hitler halte sich versteckt“, sagt Scherbakowa. Hitler aus dem Hut zaubern, mit ihm drohen – hätte ja nochmal nützlich sein können.
Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hielt Scherbakowa Hitlers Überbleibsel selber in der Hand. Durch Zufall entdeckte jemand im Staatlichen Archiv der Russischen Föderation eine Zigarettenschachtel, in der sich Teile des Gebisses und Schädelsplitter fanden. Es war zwar nicht die von Rschewskaja aber trotzdem ein Beweisstück, verborgen all die Jahre. „Das war ziemlich absurd, und vielleicht wollte Stalin auch selber nicht glauben, dass sich ein Diktator einfach so umbringt und nichts von ihm bleibt“, glaubt Scherbakowa. Jedenfalls konnte Reschewskaja erst nach dem Tod Stalins ihre Geschichte publizieren.
Eine Begegnung mit „Goebbels“ im Zug
Die Gruppe ist langsam zum Holocaust-Mahnmal herübergewandert. Scherbakowa streut noch schnell eine Geschichte ein: Über ihre Begegnung 1972 in einem Zug aus Ost-Berlin mit dem deutschen Schauspieler Horst Giese, der unter anderem im sowjetischen Kriegsdrama „Befreiung“ Reichspropagandaminister Joseph Goebbels spielte und sich ihr mit perfekter Maske während der Fahrt präsentierte. Dabei gehörte der Mord der Nationalsozialisten an Juden in den besetzten Gebieten der Sowjetunion wie beispielsweise 1941 in Babyn Jar lange zu den dunklen Kapiteln der sowjetischen Kriegsgeschichte. Selbst anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27.Januar 1945 fiel kein Wort über die jüdischen Insassen. In Berichten sollte nur von Sowjetbürgern die Rede sein. „Stalin wollte auf keinen Fall als Befreier der Juden da stehen. Es begann ein schrecklicher staatlicher Antisemitismus“ , so Scherbakowa.
Die Germanistin, selber jüdischer Herkunft, wirft Russlands Präsident Wladimir Putin nicht nur in diesem Punkt den Missbrauch der Erinnerung im Ukrainekrieg und die Fälschung der Kriegsgeschichte vor. Die Ukrainer seien schon immer Nazis und Antisemiten gewesen, heißt es jetzt in der offiziellen Propaganda. Angebliche oder tatsächliche Belege über die Kollaboration der lokalen ukrainischen Bevölkerung mit den Nationalsozialisten tauchen immer häufiger auf. Der 9. Mai sei inzwischen Bühne für einen aggressiven Militarismus geworden, sagt die Memorial-Chefin.

Solche Kritik bleibt im heutigen Russland nicht ohne Folgen: Die Historikerin und Germanistin wurde kürzlich von Moskau zur ausländischen Agentin erklärt – mit weiteren persönlichen Konsequenzen zum Beispiel für ihr Vermögen. Nach Russland reisen kann sie ohnehin nicht – wie auch die meisten anderen Memorial-Mitarbeiter nicht. Nur noch wenige arbeiten vor Ort.
Und auch wenn es immer wieder gelingt, neue Dokumente aus russischen Archiven oder von Privatpersonen zu bekommen – die Organisation muss sich ein Stück weit neu erfinden, um ihrer Aufklärungsarbeit auch aus dem Exil heraus nachkommen zu können. Dafür hat sie ihren Namen in „Zukunft Memorial“ geändert, will professioneller werden – auch mit Hilfe einer prominenten deutschen Werbeagentur wie Scholz & Friends. „Zukunft beginnt mit Erinnern. Erinnern ist Widerstand“, lautet einer der neuen Slogans. Bis zum Ende des Jahres soll das riesige historische Archiv digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht werden. „Der Verlust unserer Räume, Archive und Strukturen in Moskau kann uns nicht zum Schweigen bringen“, sagt Scherbakowa. „Im Gegenteil: Wir verteidigen eure und unsere Freiheit. Und wir kämpfen weiter für eine demokratische Zukunft Russlands.“
Zwangsarbeiter – Opfer zweier Diktaturen
Zu den Millionen Dokumenten, die Memorial gesammelt hat, gehören hunderttausende Briefe, Postkarten, Fotos, Agitationsplakate, Interviews - nicht nur zur Zwangsarbeit im sowjetischen Gulagsystem sondern auch im nationalsozialistischen Deutschland. Ab Ende 1941 wurden rund drei Millionen Ostarbeiter zur Zwangsarbeit im Deutschen Reich verpflichtet, aus Polen, der Ukraine, Belarus und Russland. 26 Millionen Menschen wurden insgesamt zur Arbeit in der Industrie oder in landwirtschaftlichen Betrieben gezwungen. In Berlin existierten in diesen Jahren an die 3000 Lager für rund 500 000 Zwangsarbeiter, so auch eines im östlich gelegenen Stadtteil Schöneweide.
Die steinernen Originalbaracken des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit dort widerstanden den schweren Luftangriffen in den letzten zwei Jahren des Krieges. Jetzt ist in den restaurierten Flachbauten eine Ausstellung zur „Vergessenen Befreiung“ zu sehen – zu der „Zukunft Memorial“ beigetragen hat. „Gerade die Sammlung persönlicher Dokumente von Memoral ist herausragend“, sagt die Leiterin des Zentrums, Christine Glauning. „Ich glaube, es gibt keine Stelle, wo soviel zu den ehemaligen Ostarbeitern zusammengetragen wurde.“ Dabei fiel es einer ganzen Reihe von ihnen offenbar nicht leicht, über diese Zeit zu sprechen. „Viele haben nicht einmal ihren Ehepartnern davon erzählt“, so Scherbakowa. Manche schämten sich offenbar, keinen Widerstand geleistet zu haben, zum Beispiel bei der Arbeit in deutschen Rüstungsfabriken. In der Sowjetunion wurden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene oft nach ihrer Rückkehr als Menschen zweiter Klasse behandelt, nicht wenige landeten als angebliche Kollaborateure oder Verräter im Gulag. „Sie wurden Opfer zweier Diktaturen“, sagt Scherbakowa.

Drei Stunden hat die Chefin von Zukunft Memorial nun fast ununterbrochen geredet, von Menschen, Mythen und verdrängten Wahrheiten. Exilrussen und -russinnen wie Scherbakowa wollen als Stimme eines anderen Russland gehört werden. Schade, dass diesen Stimmen so wenige zuhören.