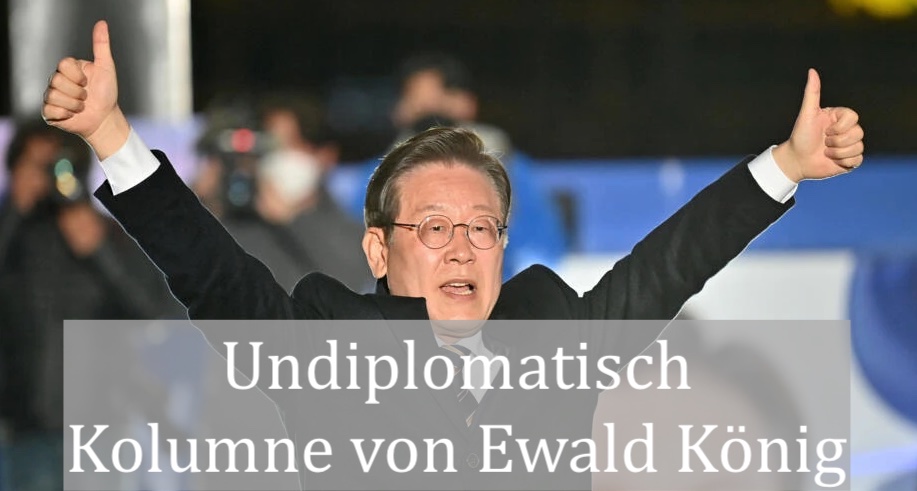diplo.news
Friedensnobelpreis für Donald Trump – mehr als eine Schnapsidee?
Kolumne von Michael Backfisch

Mit einer ordentlichen Portion Polemik könnte man die Frage stellen: Hat der Mann noch alle Tassen im Schrank? Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump allen Ernstes für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Trump schmiede „in diesem Moment Frieden, in einem Land, in einer Region nach der anderen", sagte Netanjahu am Montag zu Beginn eines gemeinsamen Abendessens im Weißen Haus. Die Intention hinter der Schmeichelei lag auf der Hand. Der Regierungschef will Trumps Ego streicheln, ihn milde stimmen. Wer weiß, wann der nächste große Militärschlag im Nahen Osten ansteht?
Aber seien wir fair und fragen: Hat Trump bei den großen Konflikten der internationalen Politik – dem Ukraine-Krieg und den Spannungen rund um Gaza und den Iran – zumindest Dinge ins Rollen gebracht? Im Fall der Ukraine wurde der Amerikaner zunächst Opfer der eigenen Prahlerei. Er könne den Krieg „binnen 24 Stunden beenden", hatte er im Präsidentschaftswahlkampf angekündigt. Später spielte er die Bemerkung mit dem Satz herunter, er sei „ein wenig sarkastisch" gewesen. Immerhin ergriff er nach seiner Amtseinführung im Januar die Initiative. Im Frühjahr übte er starken Druck auf die Ukraine und Russland aus, eine 30-tägige bedingungslose Waffenruhe zu vereinbaren – und lockte beide Länder mit lukrativen Wirtschaftsbeziehungen nach dem Ende des Krieges. Andernfalls drohten Sanktionen. Es schien, dass die Dinge durch Trumps Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz in Bewegung gerieten.
Sein Sondergesandter Steve Witkoff traf sich in Saudi-Arabien separat mit Vertretern der beiden Länder. Die Ukraine erklärte sich zur Feuerpause bereit. Russland verfuhr nach dem Radio-Eriwan-Prinzip: „Ja, aber." Moskau sagte zu, die Waffen schweigen zu lassen, wenn die „Ursachen des Konflikts" beseitigt würden. Also: Entwaffnung der Ukraine bis auf ein Minimum, keine Nato-Mitgliedschaft, kremlfreundliche Regierung in Kiew, Rückabwicklung der 1999 begonnenen Nato-Osterweiterung. Die gleiche Vogel-friss-oder-stirb-Haltung legten die russischen Vertreter bei bilateralen Gesprächen mit ukrainischen Emissären in Istanbul an den Tag. Kiew lehnte dies als bedingungslose Kapitulation ab.
Der US-Präsident machte den Fehler, den Ukraine-Krieg mit einer transaktionalen Politik beenden zu wollen. Es ging ihm nicht um demokratische Werte oder Völkerrecht. Trump war auf kurzfristige Vorteile für sich und sein Land aus. Dabei saß er der Illusion auf, einen direkten Draht zum russischen Präsidenten Wladimir Putin zu haben und Weltkonflikte sozusagen auf dem kurzen Dienstweg lösen zu können. Doch Putin verstand es in mehreren Telefonaten meisterhaft, Trump zu schmeicheln, die Bereitschaft zu einer Feuerpause vorzugaukeln, ohne in der Sache einen Millimeter Zugeständnisse zu machen.
Trumps Diplomatie hat zudem einen Konstruktionsfehler: Der Amerikaner begreift sich nicht als ehrlicher Makler, der beide Konfliktparteien gleichermaßen ködert und bedrängt. Trump verfolgte vielmehr eine asymmetrische Vorgehensweise mit viel Sympathie für Putin und vehementem Druck auf den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Der mit allen Wassern gewaschene Putin hat Trump ins Leere laufen lassen. Das scheint nun auch dem US-Präsidenten zu dämmern. „Wir bekommen von Putin eine Menge Blödsinn aufgetischt", räumte Trump am Dienstag ein. „Er ist die ganze Zeit sehr nett, aber es stellt sich heraus, dass es bedeutungslos ist." Eine sehr, sehr späte Erkenntnis für den angeblich mächtigsten Mann der Welt.
Knapp eine Woche nach dem verkündeten Stopp der bereits zugesagten Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine legt Trump nun eine 180-Grad-Wende hin: Angesichts der brutalen Bombardements der Russen wolle er zusätzliche Verteidigungswaffen schicken, betonte er. Aber es bleibt dabei: Trump hat im Ukraine-Krieg kein Konzept. Er wirkt wie ein von emotionalen Impulsen Getriebener.
Im Nahen Osten fällt die Bilanz komplizierter aus. Der Einsatz von bunkerbrechenden US-Bomben auf drei iranische Nuklearanlagen spaltet die internationale Bühne in zwei Lager: Die einen sagen, die Gefahr einer iranischen Atombombe sei zumindest für eine gewisse Zeit gebannt. Die anderen kritisieren einen eklatanten Bruch des Völkerrechts. Die massive Demonstration militärischer Macht durch die USA und Israel bietet allerdings die Chance, dass das Mullah-Regime nun wasserdichten Kontrollen zustimmt und die Option auf die Entwicklung von Kernwaffen nachweisbar beerdigt. Wenn es Trump gelänge, den Iran zu einem derartigen Abkommen zu bewegen, wäre dies ein Durchbruch, der auch beim Nobelpreiskomitee in Oslo registriert werden würde. Der Chef des Weißen Hauses will eigentlich eine Übereinkunft. Sein Abgesandter Witkoff war vor den Luftangriffen nahe an einer Verhandlungslösung. Trump müsste hierfür jedoch Premier Netanjahu ins Boot holen, der schriftlichen Zusagen der Mullahs misstraut. In der Vergangenheit folgte Trump allerdings eher Netanjahu als umgekehrt.
Auch im Gaza-Krieg verspricht der US-Präsident seit Monaten, einen „Deal" zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln – bislang ohne Erfolg. Selbst wenn er eine 60-tägige Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien gegen eine Freilassung der Geiseln erreichen könnte: Ob ein derartiger Kompromiss halten würde, ist mehr als fraglich. Trump hat zwar von seiner Schimäre, den Gazastreifen zu übernehmen und in eine „Riviera des Nahen Ostens" zu verwandeln, Abstand genommen. Doch um die arabischen Staaten für ein Gaza-Abkommen zu gewinnen, müsste er eine Vision für eine Zweistaaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern präsentieren. Das wiederum dürfte Netanjahu zumindest jetzt nicht zulassen: Seine rechtsextremen Koalitionspartner wollen den Küstenstreifen mit jüdischen Siedlungen überziehen. Die Lebensbedingungen in der zusammengebombten Enklave sollen derart miserabel werden, dass die Palästinenser „freiwillig" in arabische Länder ziehen, lautet der perfide Plan.
Es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten: Entweder Trump scheitert – wie viele seiner Vorgänger. Oder ihm gelingt ein Herkulesakt, der dem Nahen Osten mehr Stabilität bringt. Ein derartiger Königs-Deal könnte so aussehen: Der politische Überlebenskünstler Netanjahu schafft es, seine rechtsradikalen Koalitionspartner loszuwerden – zum Beispiel, indem er als „Friedens-Premier" mit einem neuen Regierungs-Team wiedergewählt wird. Er ringt sich zu einer Zweistaaten-Lösung durch - ohne Hamas, mit maximalen Sicherheitsgarantien für Israel. Die arabischen Länder in der Region stimmen zu und werden in den Wiederaufbau des Gazastreifens eingebunden. Netanjahu könnte mit einer Normalisierung der Beziehungen zu wichtigen Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien belohnt werden. Die Saudis wären grundsätzlich dazu bereit, wenn die Gaza-Frage im Sinne eines Zwei-Staaten-Modells gelöst wird. Sie haben Interesse am militärischen Schutzschirm der Amerikaner, an Hightech-Waffen und an US-Nukleartechnologie.
Im kleineren Format hatte Trump immerhin bereits Erfolg: Mit dem Abraham-Abkommen fädelte er 2020 eine Anerkennung Israels durch Marokko, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und den Sudan ein. Gelänge ihm ein „Abraham 2.0"-Vertrag, wäre er tatsächlich ein ernsthafter Kandidat für den Friedensnobelpreis – egal, wie man politisch zu ihm steht.
Trump glänzte bislang durch viele Initiativen, große Versprechungen, Zickzack-Wendungen sowie durch Launen geprägte Politik-Vorstöße. Ein diplomatisches Meisterstück hat er jedoch nicht geschafft. Einen Friedensnobelpreis hat er daher nicht verdient. Sollte ihm im Nahen Osten der XXL-Wurf gelingen, sähe das anders aus. Dazu bräuchte er allerdings Geschick, die Fähigkeit zu fein justiertem Druck, einen langen Atem und die Bereitschaft, sich in die Mühen der Ebene zu begeben. Dies wäre nur mit einem neuen Trump möglich. Sehr wahrscheinlich ist dieses Szenario nicht.