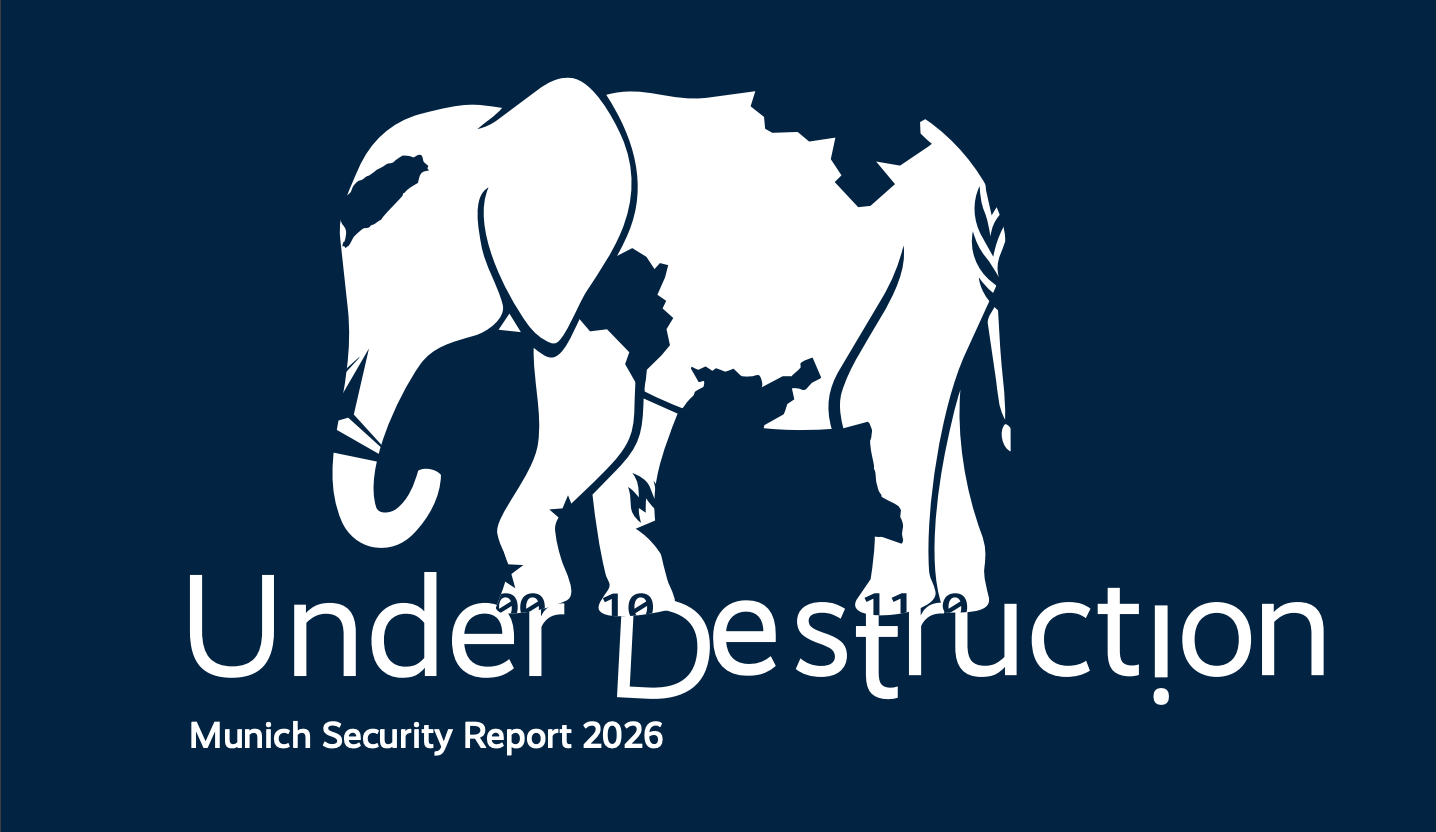diplo.news
Der Traum von digitaler Souveränität
Kolumne von Ewald König

Allmählich wird es auch für die Diplomaten ernst: Als heutige Botschafter ihre Ausbildung begonnen haben, hätten sie sich nicht träumen lassen, dass sie eines Tages mit Digitaldiplomatie und Cyberdiplomatie konfrontiert sein würden. Nun ist es aber soweit. Diese Themen sind nicht länger Domäne von Computer-Nerds, digitale Souveränität hat nicht mehr nur technische Bedeutung.
Auch Diplomaten sind gefordert. Digitale Souveränität hat strategische und diplomatische Bedeutung und verbindet Außenpolitik, Technologiepolitik und wertebasierter Diplomatie.
Europa versucht – fast schon zu spät! –, gemeinsame europäische Standards zu entwickeln und einen Weg zwischen US-Digitaldominanz und chinesischem Staatsmodell zu finden.
Es ist wie beim Fußball. Die einen schießen die Tore, die anderen kennen die Regeln besser. Auch in der digitalen Welt: Amerikaner und Chinesen dominieren den Markt, sind führend in Tech-Konzernen und Schlüsseltechnologien, digitalen Plattformen und in Halbleiterproduktion; die Europäer haben die besseren Regulierungen bei Datenschutz, Cybersicherheit und fairen Regeln im Netz, sind aber abhängig und nicht souverän.
Europa möchte eine eigenständige, sichere und transparente Cloud-Infrastruktur schaffen und die digitale Abhängigkeit von US- oder chinesischen Anbietern – wenigstens ein Stück weit – reduzieren.
Denn die Abhängigkeit ist beängstigend. Ein Land, das alle seine Verwaltungsdaten, auch hochsensible, auf Servern eines US-Konzerns speichert, hat zu wenig digitale Souveränität. Es hat kaum Kontrolle über die eigenen Daten. Es ist von fremder Technologie und Rechtsprechung abhängig. Es wird überwacht und macht sich von anderen wirtschaftlich abhängig. Es ist nicht selbstbestimmt.
Deutschland und Österreich sind nun auch auf Regierungsebene aufgewacht. Die neue Bundesregierung in Berlin hat vor ein paar Wochen das Digitalministerium gegründet und einen Topmanager, Karsten Widlberger, mit dessen Aufbau beauftragt. Nur so nebenbei: Ein seltenes Experiment, jemanden mit fachlicher Kompetenz zum Ressortchef zu machen und nicht jemandem mit bloß politischer Begabung. Auch die Bundesregierung in Wien machte vor wenigen Monaten das Digitale zur Chefsache, wenn auch nicht mit eigenem Ministerium. Der österreichische Digital-Staatssekretär, Alexander Pröll, ist direkt im Bundeskanzleramt angesiedelt.
Man ahnt, welche Probleme die beiden mit anderen Ressorts haben dürften. Einerseits erzeugt ein neues Regierungsamt allgemein eine große Erwartungshaltung, die schwer zu befriedigen sein dürfte. Andererseits wollen sich andere Ressorts nichts dreinreden lassen oder Kompetenzen abgeben. Allein dies erfordert hohes – analoges – diplomatisches Geschick.
Wildberger und Pröll haben sich in dieser Woche in Berlin zum Austausch getroffen. Beide sind sich einig, Europas digitale Souveränität zum Schwerpunkt ihrer Arbeit zu machen. "Wir müssen Herr unserer eigenen Daten sein“, sagte Pröll nach dem Gespräch mit Wildberger. "Es gilt hier europäisch zu denken und national zu handeln.“ Ihre Kernbotschaft: Digitale Souveränität sei die Grundlage politischer Handlungsfähigkeit. Es gehe um Wahrung der Datenhoheit, Kontrolle über Speicherung, Verarbeitung und Zugriff, um weniger Abhängigkeit von Global Playern und um das Setzen gemeinschaftlicher Standards in Europa.
Wenn Österreich im September zum TTE-Rat (=Verkehr, Telekommunikation und Energie) nach Wien einlädt, soll eine verbindliche EU-Charta der digitalen Souveränität erarbeitet werden. Ziel ist eine gemeinsame europäische Linie, allerdings ohne die nationale Entscheidungsfreiheit aufzugeben.
Das ist auch für die Diplomatie kein Zukunfts-, sondern schon ein Gegenwartsthema. Nicht nur in der Außenpolitik, sondern auch auf der Ebene der Konsulate und der Visavergabe. Brisantes Lehrmaterial für alle diplomatischen Akademien, damit das Digitale für die künftigen Botschafter kein Neuland ist.