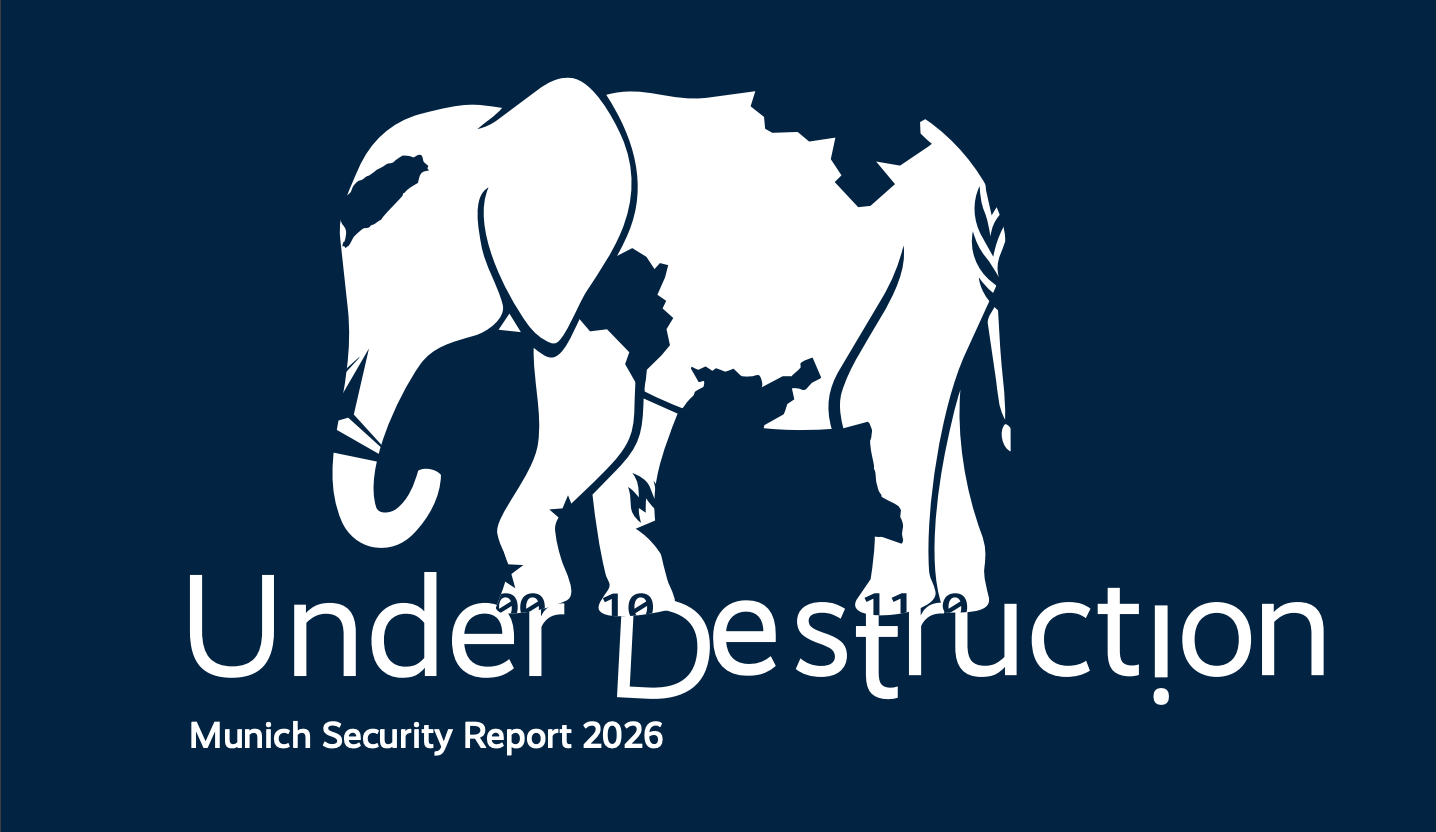diplo.news
Ein Konflikt, anderer Schauplatz, gleiche Fehler
Kolumne von Gudrun Dometeit
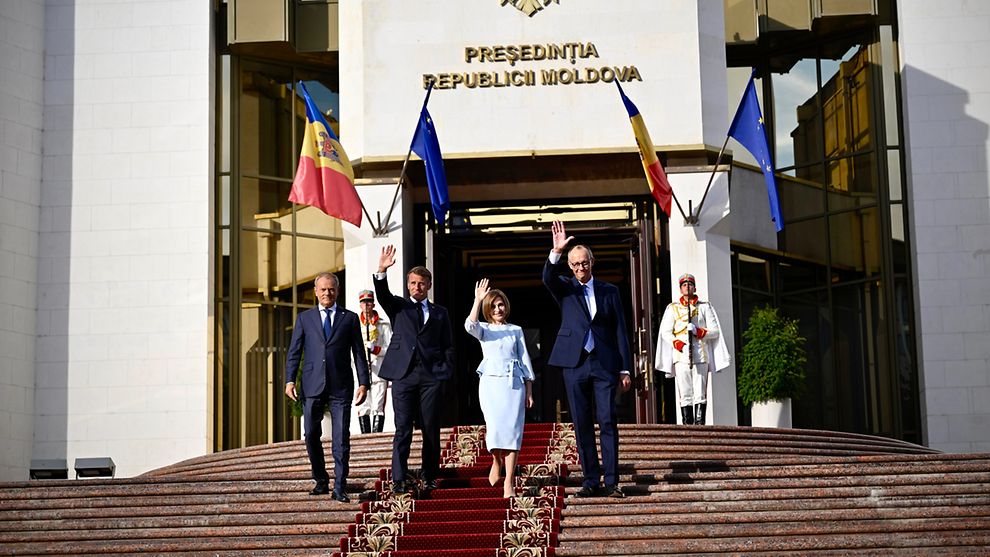
Es war um das Jahr 2000 herum, als ich besonders häufig zu Recherchen in die Republik Moldau reiste. Entweder vor Wahlen oder auf Einladungen, mir den Aufbau eines modernen Weinbaus anzusehen. Oder um Gerüchten über schwunghaften Organhandel nachzugehen. Oder sogenannte Waisendörfer zu besuchen, in denen fast nur noch Kinder mit ihren Großeltern lebten, weil die Eltern irgendwo im Westen ihr Geld verdienten. Arbeitsplätze gab es in Moldau wenige, dafür umso mehr Oligarchen, die es schafften, selbst aus dem ärmsten Land Europas reichlich für sich selber herauszuschlagen.
Ich erlebte ein sehr traditionelles, ländlich geprägtes Land, einen Vielvölkerstaat, eingeklemmt zwischen Rumänien und der Ukraine, dessen begrenztes Territorium sich Moldauer, Rumänen, Bulgaren, Ukrainer, Russen, Gagausen, Roma, Juden und Belarussen teilten. Und schon damals war Moldau hin- und hergerissen zwischen Russland und dem späteren EU- und Nato-Mitglied Rumänien, zu dem Teile Moldaus einst gehörten. Russland besetzte kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit von Moldau den östlichen Landesteil Transnistrien.
Heute, über 20 Jahre später, hat sich an dieser Situation trotz einiger Reformen in Wirtschaft und Justiz erschreckend wenig geändert. Der Transnistrienkonflikt ist nicht gelöst, die traditionelle Agrarwirtschaft spielt noch immer eine große Rolle, Oligarchen mischen noch immer heftig in der Politik mit - auch dann, wenn sie wie im Falle des prorussischen Oppositionspolitikers Ilan Shor in ihrem Heimatland wegen Betrugs verurteilt sind – und Moldawien ist noch immer eines der ärmsten Länder Europas. Der Brain Drain hat sich über all die Jahre fortgesetzt. Mittlerweile ist die Bevölkerung seit Anfang der neunziger um 35 Prozent auf rund 2,4 Millionen Menschen geschrumpft. Jetzt gehen nicht nur Arbeiter, die einen Job auf dem Bau suchen, sondern auch junge Unternehmer, die Moldau dringend zu Hause bräuchte.
Und dennoch spielt die Lösung dieser Dauerkrise, die lange vor dem Ukrainekrieg begonnen hat, vor den am Sonntag stattfindenden Parlamentswahlen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Stattdessen beherrscht die Geopolitik den Wahlkampf. Wer ist für Russland, wer für Europa? Die Polarisierung wird befeuert von außen. Im Schatten des Ukrainekrieges baut sich die nächste Konfliktfront immer höher auf.
Moldaus pro-europäische Präsidentin Maia Sandu und ihre Partei Aktion und Solidarität (PAS) müssen um die Regierungsmehrheit bangen. Und verantwortlich dafür machen sie Russland. Moskau führe einen „unbegrenzten hybriden Krieg“ unbekannten Ausmaßes und mische sich mit „hunderten von Millionen“ in die Wahlen ein, um Stimmen zu kaufen, erklärte Sandu, eine Harvard-Absolventin und ehemalige Weltbank-Ökonomin. Bei Durchsuchungen im ganzen Land wurde nach offiziellen Angaben gerade erst ein vom russischen Militärgeheimdienst GRU unterstütztes Netzwerk zerschlagen, zu dem in Serbien ausgebildete Moldauer gehören sollen, die in Schusswaffengebrauch und Gewalttaten gegen die Polizei geschult wurden. Vorwürfe, die der prorussische Parteienblock unter Führung des früheren Präsidenten Igor Dodin zurückweist.
Die EU stockte im Gegenzug ihre Finanzhilfen erheblich auf 1,9 Milliarden Euro bis 2027 auf, um den moldauischen Haushalt zu entlasten und Sandu die Möglichkeit für Wahlgeschenke zu geben. EU-Emissäre geben sich seit Wochen die Klinke in die Hand und reisen durchs Land, um für Europa zu werben. Ende August sprinteten als prominente Wahlkampfhelfer sogar Donald Tusk, Emmanuel Macron und Friedrich Merz zum Blitzbesuch nach Chisinau, Moldaus Hauptstadt. Moldaus ehrgeiziges Ziel: Es will schon 2030 der EU beitreten, also nur sechs Jahre nach Aufnahme der Beitrittsgespräche. Auch Rumänien mischt sich beim Nachbarn kräftig ein: Einzelne Oppositionspolitiker haben Einreiseverbot, rechte Parteien dort plädierten lautstark für eine Wiedervereinigung mit Rumänien – was naturgemäß bei der russischsprachigen Bevölkerung in Moldau gar nicht gut ankommt.
Sicher, die EU will verhindern, dass Moskau seinen Einfluss auf eine weitere frühere Sowjetrepublik ausdehnt oder behält. Trotzdem ist die Frage, ob man Moldau einen Gefallen mit dem immer stärkeren Engagement tut oder ob man damit die Polarisierung im Land weiter verschärft. Die regierende PAS hat die meisten Anhänger in der Hauptstadt, in der Provinz gewinnt tendenziell die Opposition aus Sozialisten und russophilen Parteien. Das Referendum zur EU-Mitgliedschaft im vorigen Jahr gewann Sandu nur mit äußerster knapper Mehrheit – wozu massiver Stimmenkauf beigetragen haben soll. Interessanterweise stimmten allerdings im russisch kontrollierten Transnistrien 30 Prozent für den Beitritt, während es im südlichen, sehr traditionellen Gagausien nur fünf Prozent waren.
Man sollte auch wissen, dass die Pro-Europäerin Sandu die vergangenen Wahlen – sie regiert seit 2020 – vor allem mit Hilfe der Diaspora gewonnen hat. Nach Schätzungen leben rund eine Million Moldauer im Ausland, die als die eigentliche Hausmacht der Präsidentin gelten. Sie müssten bei dieser Wahl erneut mobilisiert werden. Das heißt aber auch, dass Emigranten, die oft schon Jahre im Ausland leben und sich von der Lebenswirklichkeit ihrer Landsleute entfernt haben, das Schicksal ihres Landes entscheidend mitbestimmen werden. Auch das könnte die Zersplitterung einer Gesellschaft verstärken, die sich ohnehin schwer tut, eine eigene moldauische Identität aufzubauen.
Wäre es da nicht klüger, wenn der Westen nicht wie einst im Falle der Ukraine das Land vor die Wahl stellen würde nach dem Motto: Entweder wir oder Russland oder gar keiner? Wenn er, statt bedingungsloser Hilfe für eine Seite anzubieten, auf die komplexe Gemengelage im Land eingehen würde? Der ehemalige liberaldemokratische Regierungschef und Außenminister Iurie Leanca geht mit der EU, aber vor allem den eigenen Landsleuten ins Gericht. Die Moldauer müssten endlich ernsthaft über ihre Zukunft, zum Beispiel sein Wirtschaftsmodell, diskutieren. Die Regierung habe ihre – vor vier Jahren fast absolute – Mehrheit nicht genutzt, das Wirtschaftswachstum liege gerade mal bei 0,4 Prozent. Der Slogan von damals "Wir bekämpfen die Korruption" sei durch "Wir bekämpfen Russland" ersetzt worden. "Das größte Problem jedoch sind wir Moldawier selber, nicht die Russen, die Europäer oder sonstwer." Die EU dürfe die Ineffizienz der Regierung nicht einfach so hinnehmen.
Aber das nennt man wohl geopolitische Interessen: Da drückt der Westen auch schon mal ein Auge zu, wenn es um ein übergeordnetes Ziel geht, nämlich den Systemkonflikt mit Russland zu gewinnen. Nicht wenige Moldauer fürchten aber, ihr Land könnte dabei ebenso zum Schlachtfeld werden wie die Ukraine und schlagen stattdessen eine Neutralitätspolitik vor. Das nur als russisches Narrativ zu diffamieren, ist falsch. Eine Diskussion wäre die Idee doch allemal wert, wenn es um den Frieden geht. Oder nicht? Wer einen Fehler macht und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Hat Konfuzius mal gesagt.