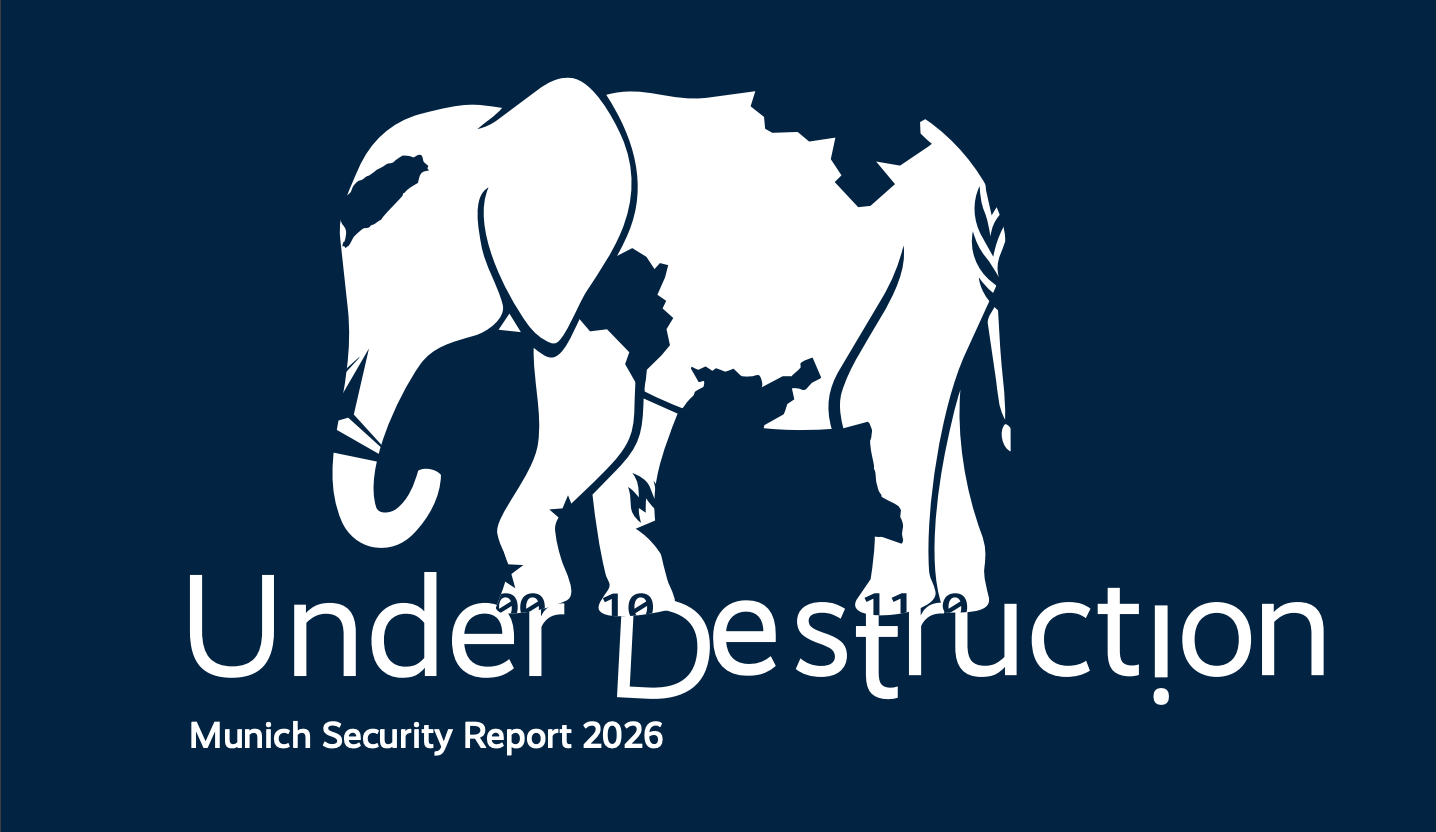diplo.news
„Mit den Höckes dieser Welt würde ich nie eine Sekunde verhandeln können und wollen“
Von Gudrun Dometeit

In Zeiten geopolitischer Turbulenzen sind die Worte ehemaliger Spitzenpolitiker besonders gefragt. Weil die Elder Statesmen gemeinhin als frei von Parteirücksichten und Karrieregedanken gelten, quasi mit abgeklärter Einsicht und größerer Weitsicht, mit amüsierender Leichtigkeit das Weltgeschehen bewerten können. Wolfgang Schüssel, österreichischer Ex-Kanzler und gerade 80 Jahre alt geworden, gehört wohl in diese Kategorie. In Kreisen der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) ist er immer noch ein Politstar, obwohl seine Kanzlerschaft vor 18 Jahren endete, in Deutschland ist der glühende Europäer besonders bekannt, weil er die rechtsnationale Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) von Jörg Haider hoffähig machte, aber auch in die Schranken wies.
Am Donnerstag Abend stellte sich Schüssel den Fragen bei einer Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung in Berlin, in deren Kuratorium er lange Zeit Mitglied war. Äußerer Anlass des Events: Ein neues Buch mit dem Titel: „Mit Zuversicht. Was wir von gestern für morgen lernen können.“ Alle fünf Jahre schrieb der ÖVP-Politiker eines, schon zum 70. und 75. Geburtstag schenkte er sich Selbstreflexionen. Dabei interessierten Politikerautobiografien „von der Wiege bis zur Bahre“, so kokettiert er gleich zu Anfang, doch eigentlich niemanden, und erntet die ersten wohlkalkulierten Lacher. Eine Autobiografie ist das Werk tatsächlich nicht, eher eine essayistische Betrachtung zentraler Lebensthemen wie Mut, Macht, Frieden, die Bedeutung von Geschichte.
Woher er angesichts der vielen Krisen und Konflikte seine Zuversicht für die Zukunft nehme, wird er gefragt. Schüssel schildert seine Kindheit in Wien, beschreibt, wie die mit ihm schwangere Mutter im Kohlenkeller ausharrte, während das Haus über ihr von einer britischen Bombe getroffen wurde, wie sie sich und ihren Sohn durch Arbeit bei einem Bauern durchbrachte. Wien sei nach dem Krieg zu einem Drittel zerstört, Österreich 1948 laut UN das am stärksten von einer Hungersnot bedrohte Land gewesen. Heute liege die Lebenserwartung über 80 Jahre, die Gesundheits-, Wohn- und Bildungssituation sei eine ganz andere. „Es gibt überhaupt keinen Grund, negativ nach vorne zu blicken. Ich glaube, dass man vielen in Mitteleuropa auch wieder die Zuversicht auf die Zukunft geben kann.“ Das gelte auch im größeren Zusammenhang. Im Laufe der Menschheitsgeschichte seien viele „unfassbare Dinge“ geschehen, vom aufrechten Gang des ersten Menschen über die Schrift, den Buchdruck, das Internet. Mit Hilfe von Computern könnten Blinde heute wieder sehen. „Die Kräfte der Hoffnung sind längerfristig immer stärker gewesen als die Kräfte der Zerstörung“, sagt Schüssel.
Die Mutter spielte stets eine prägende Rolle für ihn ebenso wie das Christentum. Schüssel besuchte das von Benediktinern geführte Schottengymnasium in Wien und engagierte sich in der kirchlichen Jugendarbeit. Der Vater dagegen habe sich schnell „vertschüsst“, und als er ihm später einmal die Frage stellte, was er denn eigentlich während der Nazizeit gemacht habe, habe er sich, so Schüssel, eine schallende Ohrfeige eingefangen. Anschließend habe der Vater einen Herzanfall bekommen, das Thema sie nie wieder angeschnitten worden.
Schüssel erinnert sich an einen Pater, der ihn besonders beeindruckte, weil er sich rührend um junge Strafgefangene kümmerte, keine Aufgabe, die die Kirche in den sechziger Jahren als prioritär betrachtete. Der sei nicht besonders charismatisch gewesen, eher leise, aber man habe ihm einfach zugehört. „(Solche) Typen werden rar.“ Er kommt später noch einmal auf besondere Persönlichkeiten zurück, als es um Ehrlichkeit und Klarheit in der Politik geht. Da lobt der Österreicher den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos, früher Grüne) und Schwedens Regierungschefin Mette Frederiksen (Sozialdemokraten), weil sie Probleme offen ansprächen. In der Migrationsdebatte und während der Coronazeit seien Probleme einfach weggewischt worden. „Die Impfflicht wurde von der Bevölkerung in Österreich als absolut untragbarer Eingriff empfunden, abweichende Meinungen konnten nicht thematisiert werden.“ Solche gesellschaftlichen Konflikte instrumentalisiere Russland für seine Zwecke.
Die gefährliche Selbstzufriedenheit der Europäer
Was er denn der deutschen Politik in Sachen AfD rate? Die Partei habe am Anfang eher liberale oder libertäre Elemente gehabt, aber das sei mittlerweile total gekippt. „Mit den Höckes dieser Welt würde ich nie eine Sekunde verhandeln können und wollen“, sagt Schüssel und äußert zugleich – milde - Kritik an den etablierten Parteien in Deutschland, die der AfD bis jetzt das Amt eines Bundestags-Vizepräsidenten verweigern. Er halte das nicht für besonders klug, in Österreich verhalte man sich da anders. Wenn eine Partei demokratisch gewählt, im Bundestag vertreten sei und Anspruch auf einen Vizepräsidenten oder Ausschussvorsitz habe, sei ihr dieser selbstverständlich zu geben. Die Parteien der Mitte hätten verlernt, wie man Wahlkampf mache und mit Bürgern vor Ort wieder in Kontakt komme.
Die eigene Entscheidung, nach der verlorenen Wahl von 1999 mit der FPÖ zusammenzugehen, rechtfertigt der Altkanzler. Die EU-Staaten reduzierten damals monatelang ihre Kontakte zur österreichischen Regierung auf ein Minimum, im Inland gab es immer wieder Demonstrationen gegen die Liaison. Haider sei ein „interessanter Bursche“ gewesen, ein Chamäleon und hochintelligent. In einer guten Phase habe man mit ihm konstruktiv zusammenarbeiten können. Eigentlich habe er mit der ÖVP – die 415 Stimmen weniger als die FPÖ hatte – in die Opposition gehen wollen. Nach gescheiterten Koalitionsgesprächen mit der SPÖ stellte die ÖVP nach Schüssels Worten als Grundbedingung für Verhandlungen mit der FPÖ ein Ja zu Europa. Die Zusammenarbeit sei dann völlig in Ordnung gewesen, der europäische Verfassungsvertrag später mit nur einer Gegenstimme im österreichischen Parlament angenommen worden.
Die Europäer warnte Schüssel vor Selbstzufriedenheit. Dies sei der gefährlichste Fehler. Die aktuellen Krisen sollten ein Weckruf sein, um Fehler zu beseitigen und es besser zu machen, findet er. Nach 1991, der deutschen Wiedervereinigung und dem Wegfall des Eisernen Vorhangs hätten alle gedacht, man habe es geschafft. Eigentlich sei Europa damals gut gerüstet gewesen, aber dann habe man vergessen, dass die Sicherung der Außengrenzen und der Schutz der Bevölkerung die ureigenste Aufgabe eines Staates sei. 2.000 Milliarden Euro Friedensdividende seien in den Sozialstaat geflossen. Man habe sich auf die Amerikaner verlassen und eigene Sicherheitsbelange vernachlässigt. „Unter unseren Augen in Österreich hat so jemand wie (der ehemalige Wirecard-Chef) Jan Marsalek europaweit ein russisches Netzwerk aufbauen wollen. Wir waren einfach naiv.“ Der Österreicher Marsalek errichtete nicht nur ein Scheinimperium, er soll auch Agent des russischen Geheimdienstes gewesen und nach Moskau geflüchtet sein.
Österreichs Neutralität und Kampfeinsätze
Schüssel forderte, endlich um der Datensicherheit willen eine europäische Cloud aufzubauen und eigene Satelliten ins All zu schießen, statt dies einem Elon Musk oder den Chinesen zu überlassen. Souveränität könne nie hundertprozentig sein, aber gefährlich seien einseitige Abhängigkeiten von russischem Gas, von Industriegütern aus China oder Software aus den USA. Immerhin sei das Bewusstsein bei den Entscheidungsträgern jetzt vorhanden. Der Kern für Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum in Europa sei Innovation. Allerdings wanderten gute Ideen ab, weil hier der Kapitalmarkt fehle. „Am Gehirnschmalz fehlt es nicht, aber wir Europäer müssen unsere Stärken besser darstellen. Wir müssen uns mehr aufplustern.“ Europäische Firmen investierten in den USA 5.000 Milliarden Dollar in den USA, die amerikanischen etwa genausoviel in Europa. Die US-Firmen brächten aber jedes Jahr rund 4.000 Milliarden Dollar Gewinn aus Europa nach Amerika. Die Sperre von Mitteln für USAid nannte Schüssel eine große Chance für die Europäer, in die Lücke zu stoßen, die die US-Agentur für Entwicklungszusammenarbeit lasse. Schüssel kritisierte aber auch die EU-Strukturen. Brüssel müsse nicht alles entscheiden, sondern solle sich auf die wichtigsten Fragen wie Sicherheit oder Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren.
Auf die Frage, ob die Neutralitätspolitik Österreichs noch zeitgemäß sei, meinte der frühere Regierungschef, dass sein Land ja im EU-Rahmen gar nicht mehr neutral sei. Es habe seine Verfassung einst dahingehend geändert, dass es mit einem UN- oder EU-Mandat politische und wirtschaftliche Sanktionen mittragen, Militärtransporte und Waffenlieferungen genehmigen und sogar an Kampfeinsätzen teilnehmen könne.
Und wie ist der einstige Vollblutpolitiker, heute Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen, mit - durchaus nicht wenig - Kritik während seiner Karriere umgegangen? Wenn es ihm wirklich schlecht gegangen sei, sagt er, habe er sich schon mal ans Klavier gesetzt und Boogie-Woogie gespielt. Außerdem sei er zu Hause doppelt betreut gewesen, weil sowohl Ehefrau als auch Tochter Psychologin seien. Es werde unglaublich, witzelt er, wenn einem klar gemacht werde, dass es gerade nicht darum gehe, am Rednerpult von den Massen umjubelt zu werden, sondern schlicht seine eigene Schmutzwäsche wegzuräumen.