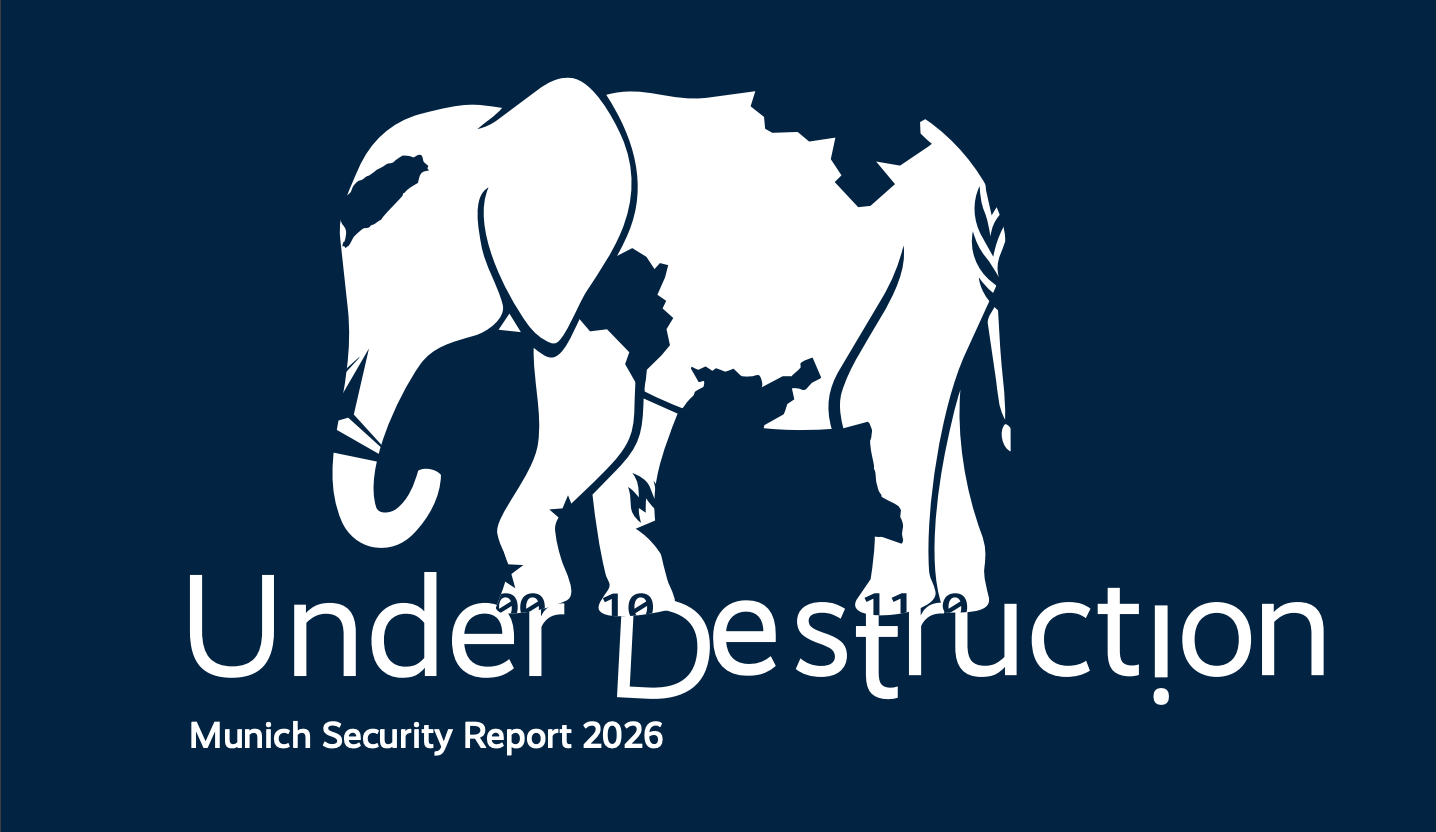diplo.news
Basketball, Sauna und ein Flieger aus Deutschland
Von Gudrun Dometeit

Wenn einer weiß, wie Entspannung geht, dann Markku Reimaa. Mindestens 18 Jahre seines Diplomatenlebens widmete der Finne der kollektiven Sicherheit in Europa, erlebte, wie die waffenstarrenden Gegner des Kalten Krieges, die Staaten des Warschauer Paktes und der Nato, sich allmählich annäherten. In Reimaas Stimme schwingt heute noch Stolz mit, den historischen Prozess vom ersten Tag an begleitet zu haben, angefangen mit der Vorbereitung der ersten Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 1973 bis zur Unterzeichnung der Schlussakte am 1. August 1975 in Helsinki und der letzten Nachfolgekonferenz 1990 in Paris, die den Kalten Krieg für offiziell beendet erklärte. Die Ost-West-Konferenz, von manchen Historikern mit der Bedeutung des Wiener Kongresses verglichen, ordnete nicht nur das Europa der Nachkriegszeit neu, in dem zwei politische und wirtschaftliche Systeme miteinander rivalisierten. Vor allem war sie ein großartiges Stück Diplomatiegeschichte, mit allen Finessen, mit Shuttle-Diplomatie und Nebenabsprachen, an deren Anfang die Erkenntnis stand, dass militärische Stärke und Kooperation keine Gegensätze sondern zwei Seiten derselben Sicherheitsmedaille sind.
Es war im Juli 1972 - Reimaa hatte gerade seinen ersten Posten an der finnischen Vertretung in Ost-Berlin bezogen - als ihn eine überraschende Nachricht des Außenministeriums in Helsinki erreichte: Er sei eingeladen, als achtes Mitglied Teil der finnischen KSZE-Delegation zu werden. „Eine große Ehre war das“, sagt er. Schließlich war der Diplomat erst knapp 30 Jahre alt, ein junger Attaché in der Runde alter Hasen. Das neutrale Finnland hatte sich schon 1969 als Gastgeber einer europäischen Sicherheitskonferenz angeboten – es sah eine Chance, für sich und seine Neutralitätspolitik zu werben, die im geteilten Kontinent nicht überall auf Begeisterung stieß.
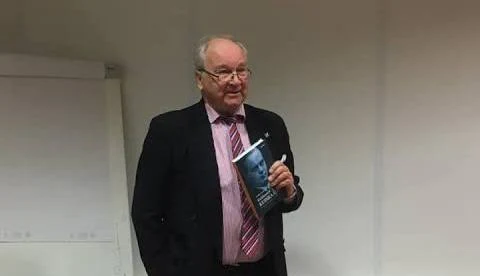
„Helsinki ist keine große Stadt“, sagt Reimaa. „Wir haben uns damals erschrocken gefragt: Haben wir überhaupt genügend Hotelkapazitäten und Konferenzräume?“ Man hatte. Kurz zuvor war die Finlandia-Halle - das futuristische Veranstaltungsgebäude des berühmten Architekten Alvar Aalto - und ein neues Interkontinental-Hotel fertig geworden, ebenso wie wenige Jahre zuvor das Konferenzzentrum Dipoli der Technischen Universität. Dorthin waren im November 1972 rund 350 Botschaftsvertreter aus NATO-15 Staaten, sieben Warschauer Pakt-Staaten und 13 neutralen Ländern zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen. „Die Russen haben sofort ja gesagt und sogar einen Vize-Außenminister geschickt", erzählt Reimaa. „Sie wollten so schnell wie möglich eine Deklaration zum Status quo nach dem Zweiten Weltkrieg verabschieden, in der die bestehenden Grenzen und ein Gewaltverzicht bestätigt werden sollten. Bis Weihnachten 1972 wollten sie fertig sein.“ Daraus wurde nichts. Anfangs von manchen als netter, aber kurzer Plausch bei Tee und Keksen gedacht, verwandelte sich die Zusammenkunft in eine ernsthafte Veranstaltung. Die ersten Arbeitsgruppen setzten sich ab Januar 1973 zusammen, und deren Ziel sollten nicht deklaratorische Phrasen sondern konkrete Vorschläge sein. Die Sowjetunion unter KPdSU-Parteichef Leonid Breschnjew stimmte zu oder jedenfalls nicht dagegen, wenn auch zähneknirschend.
Wäre es nach der Sowjetunion gegangen, hätte es die von ihr gewünschte Deklaration ohnehin viel früher gegeben. Bereits in den fünfzigern schlug sie eine Konferenz vor – die den eigenen Herrschaftsbereich im Osten absichern, Deutschland neutralisieren und die USA und Kanada aus Europa heraushalten sollte. 1967 zeigte sich die Nato tatsächlich grundsätzlich zu Gesprächen bereit – angeregt durch den damaligen belgischen Botschafter Pierre Harmel, fortan nicht nur auf militärische Abschreckung zu setzen sondern auch auf Kooperation, um den Frieden zu erhalten. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings durch Truppen des Warschauer Paktes 1968 war es zwar erstmal vorbei mit dem Gesprächswillen, aber nachdem der Westen zu der Überzeugung gelangt war, dass sich der Gewaltakt nicht gegen ihn selber richtete und sich die Sowjetunion zudem mit einer Teilnahme der USA und Kanadas bereit erklärt hatte, waren die Weichen für eine Konferenz wieder gestellt. Dazu trugen auch das Vier-Mächte-Abkommen sowie die sogenannten Ostverträge bei, die Willy Brandt mit Moskau, Warschau und Ost-Berlin zwecks Annäherung und Normalisierung der Beziehungen abschloss. Brandt betonte übrigens Anfang 1973 auf Kritik der CDU/CSU-Opposition im Bundestag, dass die Basis seiner Friedenspolitik die Partnerschaft mit den USA sei.
Der persönliche Faktor: Diplomaten aus Ost und West verbrachten sogar die Freizeit miteinander
„Wir waren eine große soziale Gemeinde“, erinnert sich Reimaa an die vielen Treffen, die nach dem finnischen Auftakt in Genf stattfanden, wohin die beteiligten Diplomaten mitsamt Familien gezogen waren. „Kein Wunder, wir hatten ja quasi 24 Stunden sieben Tage die Woche miteinander zu tun.“ Für die Osteuropäer sei der freie Umgang miteinander damals völlig neu gewesen, aber viele hätten das schnell schätzen gelernt. „In der Freizeit haben wir Basketball gegen die Sowjetvertreter gespielt, und nachher sind wir in die Sauna gegangen. Man lernte die persönlichen Eigenschaften kennen, wer zu Kompromissen bereit war oder wer zu den Doktrinären gehörte und eine harte Nuss war.“ Mit manchen konnte man sogar Persönliches besprechen wie die Erziehung der eigenen Kinder. Mit dem sowjetischen Botschafter Jurij Kaschljew diskutierte Reimaa bilateral einmal hinter verschlossenen Türen, um dann gemeinsam Vorschläge in die große Runde einzubringen. Das Ziel von Außenminister Andrej Gromyko sei es gewesen, so Kaschljew später in seinen Memoiren zur KSZE, einen völkerrechtlich bindenden Vertrag abzuschließen und damit die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs - die Anerkennung neuer Grenzen und die Teilung Deutschlands, multilateral bestätigen zu lassen. Die KSZE sollte eine Art Ersatz für einen Friedensvertrag sein.
Weil der Sowjetunion und vor allem Breschnjew dieses Ziel so wichtig war, ließ sie sich darauf ein, neben Sicherheits- und Wirtschaftsfragen auch über das heikle Thema Menschenrechte zu sprechen. Reimaas Aufgabe war es, Vorschläge zu menschlichen Kontakten, Familienzusammenführung und Informationsaustausch mit Osteuropa zu entwickeln. Und nebenher Protokoll zu führen. Doch das war angesichts der angespannten Arbeit kaum zu schaffen. Seiner Chronistenpflicht kam Reimaa erst 2008 in einem eigenen Buch („Helsinki Catch“) nach. Der junge Finne erlebte das Ringen um Worte und Prinzipien, wie die Teilnehmer vor und hinter den Kulissen redeten, wie wichtig sie sich nahmen oder mit welchen Tricks sie arbeiteten. Deutschlands oberster Diplomat Walter Scheel (FDP) verhielt sich bei der Auftaktkonferenz der Außenminister 1973 „wie der Vertreter einer Supermacht“, erinnert er sich. Scheel ließ sich mit einem Hubschrauber aus dem Osten Helsinkis zur Finlandia-Halle fliegen. Beim Abschlussempfang an einem heißen Sommerabend kredenzte er im eleganten Hotel Haikko Speisen und Getränke, die eigens ein Luftwaffen-Transporter aus Deutschland gebracht hatte. Reimaa erlebte auch, wie wenig begeistert US-Außenminister Henry Kissinger zunächst gegenüber dem multilateralen Format der Konferenz war, weil er sich in die Beziehungen zu Moskau nicht reinreden lassen wollte und die parallell stattfindenden Abrüstungsgespräche zur wechselseitigen und ausgewogenen Truppenreduzierung für wichtiger hielt. „Und er wollte verhindern, dass daraus eine Konferenz über das geteilte Deutschland wurde.“

Zur Schlusskonferenz am 1. August 1975 versammelten sich in Helsinki Staats-und Regierungschefs, insgesamt 550 Delegationsmitglieder, 3000 Assistenten, Berater und Sicherheitsleute. 550 Polizisten und Soldaten bewachten das Mammutereignis. 1410 Journalisten waren akkreditiert. Helsinkis Einwohner sahen einen endlosen Zug schwarzer Limousinen in Richtung Finlandia-Halle rollen, die im Volksmund „Kekkonens Fischfalle“ hieß. Der finnische Präsident Urho Kekkonen galt als Strippenzieher und überzeugter Förderer der Konferenz. In der Schlusserklärung verpflichteten sich die Teilnehmer – darunter Helmut Schmidt und Erich Honecker, die die frankophone alphabetische Sitzordnung immer einträchtig nebeneinander zwang – auf die Unverletzlichkeit der Grenzen, zur friedlichen Beilegung von Streitfällen, zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten und zur Wahrung von Menschenrechten und Grundfreiheiten. Sie vereinbarten wirtschaftliche Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen wie die Ankündigung von Manövern und Kommunikationskanäle für den Krisenfall.
Die Gesprächskanäle blieben offen, gerade in Krisenzeiten
Als einer der letzten Sätze sei, so Reimaa, die Formulierung aufgenommen worden, dass die Vereinbarungen nicht bedeuteten, auf eine deutsche Wiedervereinigung unter friedlichen Umständen zu verzichten. „Das war revolutionär.“ Es entsprach dem nationalen Interesse und überragenden Wunsch der Bundesrepublik Deutschland und war eines der umstrittensten Themen der Konferenz. Die Verabschiedung der Schlussakte mit diesen Prinzipien hätte auch noch scheitern können. „Im Sommer 1975 gab es eigentlich die letzte Chance.“ Auch weil die Position des immer kränklicheren Breschnjew im Politbüro der KPdSU zu bröckeln begann. Wenige Monate später begann die Sowjetunion SS20-Mittelstreckenraketen zu stationieren, die Westeuropa erreichen konnten und die Europäer vom US-Atomschirm abgekoppelt hätten. Ein klarer Verstoß gegen die Entspannungsbemühungen – wenngleich auch die Nato zur gleichen Zeit an der Modernisierung ihrer nuklearen Mittelstreckenraketen arbeitete.
Dennoch wertet Reimaa, der alle Nachfolgekonferenzen begleitete, die KSZE als Erfolg. „Sie hat einen Kanal für Dialoge angeboten, in einer Zeit internationaler Unruhe und verhindert, dass Krisen außer Kontrolle gerieten.“ Und von denen gab es viele: die Teilung Zyperns, die Militärcoups in Griechenland und Portugal 1974, der Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan 1979, das Kriegsrecht in Polen 1981oder der rasch hintereinander folgende Tod der drei sowjetischen Generalsekretäre Breschnjew, Jurij Andropow und Konstantin Tschernenko in den achtzigern. „Der größte Erfolg der KSZE war aber der friedliche Zerfall der Sowjetunion“, ist der 82-Jährige überzeugt. „Die KSZE wurde danach zu einer Art Dach für alle Staaten, die nicht mehr Teil der Sowjetunion waren.“ Auf die Helsinki-Grundsätze beriefen sich viele Oppositionelle Osteuropas. Richtig leer seien die russischen Dissidentenlisten, so Reimaa, allerdings erst unter Michail Gorbatschow geworden, beginnend mit der Rückkehr des Atomphysikers Andrej Sacharow 1986 aus dem Exil in Gorki. Und ja, die Rolle Finnlands sei vielleicht vom inhaltlichen Input her nicht so entscheidend gewesen, aber jeder habe die Gastgeberrolle seines Landes und die unermüdlichen diplomatischen Anstrengungen gelobt. „Es war auch eine symbolische Anerkennung unserer Neutralitätspolitik.“
Entscheidend für den Erfolg des KSZE-Prozesses sei das Konsens-Prinzip gewesen, auf das man sich gleich zu Anfang einigte, glaubt Reimaa. Einstimmigkeit sei nicht gefordert gewesen, es habe einfach kein Nein gegeben. „Und Konsens bedeutete immer Kompromiss.“ Auf die ideologisch reine Linie hätten alle Teilnehmer, sogar die Sowjetunion, verzichtet.
Wäre eine neue, ähnliche Konferenz in der jetzigen angespannten Lage mit einem Krieg zwischen zwei europäischen Staaten, der Ukraine und Russland, sowie einer enormen Aufrüstung wiederholbar? Wie damals zumindest als Auftakt für einen Entspannungsprozess? Schließlich war allen auch 1975 klar, dass die Konferenz in Helsinki nur der Anfang vom Ende des Kalten Krieges sein würde. Und welchen Beitrag könnte die 1995 gegründete Nachfolgeorganisation OSZE leisten? Reimaa zeigt sich skeptisch. „Die OSZE ist technisch noch vorhanden, aber sie hat keine politische Bedeutung mehr“, sagt er bedauernd. „Und so lange ein Wladimir Putin in Russland das Sagen hat, kann aus einer neuen Konferenz wenig Positives herauskommen.“ Wenn Vertrauen die wichtigste Ressource in der Diplomatie ist, hat Reimaa wohl leider recht.